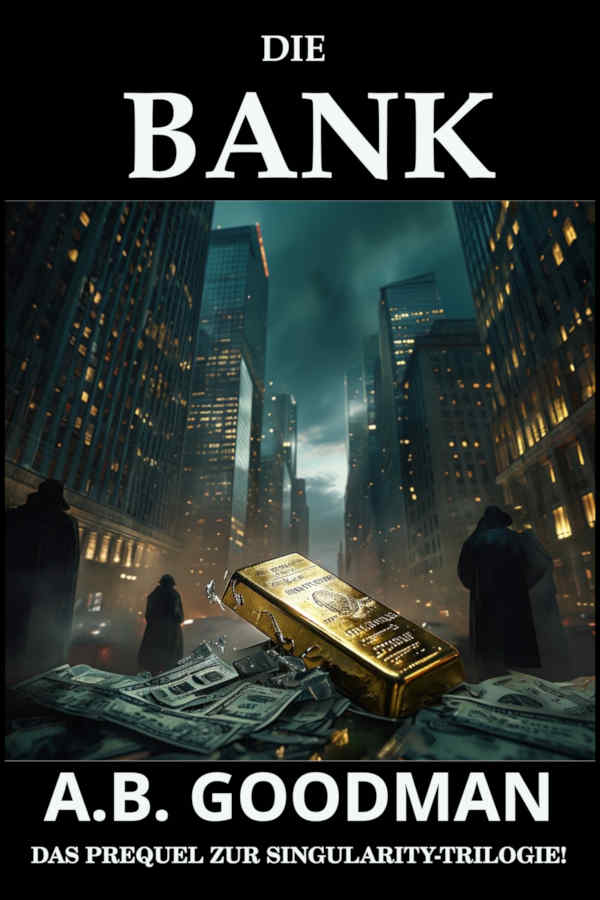
Kapitel 1 – MORD
Charlie Bakkendorf hielt sich für einen ganz normalen Mann. Er war weder tugendhaft noch bösartig, sondern lebte ein Leben, das von einfachen Wünschen und Bedürfnissen bestimmt war und in dem kein Platz für Bosheit war. Sein Titel „Tresorverwalter” bei der renommierten Investmentbank Bolton Sayres war prestigeträchtig, hatte aber wenig Bedeutung; in Wirklichkeit verwaltete Charlie nichts. Als Highschool-Absolvent ohne besondere Qualifikationen war er mehr oder weniger zufällig in diese Position gelangt.
Mit 32 Jahren war Charlie single und litt unter Einsamkeit. Das sollte sich jedoch bald ändern – zumindest glaubte er das. In nur zwei Wochen hatte Maria seine Welt auf den Kopf gestellt. Ihr Gesicht war ihm lebhaft und unwiderstehlich in Erinnerung geblieben. Er war hingerissen.
Er hoffte, dass sein Beharren darauf, sie mit dem Taxi nach Hause zu schicken, Eindruck gemacht hatte. Es war eine kleine Geste, aber eine, die seiner Meinung nach seine Aufrichtigkeit zum Ausdruck brachte. Lächelnd dachte er an ihr Kaffeetrinken zurück, das sich unerwartet zu einem charmanten Abendessen entwickelt hatte. Am Samstag würde er sie wiedersehen und ihr einen Abend bieten, der sie beeindrucken sollte: Abendessen in einem exklusiven Restaurant in New York City, gefolgt von einer Broadway-Show.
Der luxuriöse Abend würde ein Vermögen kosten – vielleicht über 1.000 Dollar –, aber ausnahmsweise machte sich Charlie keine Sorgen. Er hatte den Jackpot geknackt. Zwei Millionen Dollar. Genug, um sich jeden Traum zu erfüllen. Einen Bruchteil davon auszugeben, um Maria wie eine Königin zu behandeln, fühlte sich nicht nur machbar an, sondern auch richtig. Der 21 Club und die besten Plätze am Broadway waren nur der Anfang. Es würde vielleicht etwas Zeit brauchen, sich an seinen neuen Reichtum zu gewöhnen, aber ab Samstag war er entschlossen, ihn anzunehmen.
Die Taxifahrt zurück nach Brooklyn riss ihn aus seinen Träumen. Er griff nach seiner Brieftasche und berechnete den Fahrpreis. Alte Gewohnheiten hielten sich hartnäckig; der Gedanke, weitere 50 Dollar für den Rest der Fahrt zu bezahlen, ließ ihn zusammenzucken. Warum so viel ausgeben, wenn die U-Bahn nur 2,50 Dollar kostet? Mit einem Seufzer bezahlte Charlie den Taxifahrer und stieg an der Station 181st Street auf den Bahnsteig.
Die U-Bahn war gnädigerweise ruhig und weit entfernt von ihrem üblichen Chaos. Als Charlie in den Zug stieg, drängten sich ein paar vereinzelte Fahrgäste um ihn herum. Er genoss die relative Einsamkeit und stellte sich eine Zukunft vor, in der er es sich leisten konnte, diesen Trott hinter sich zu lassen. Bald würde er sich eine Wohnung in Lower Manhattan kaufen und zur Arbeit spazieren gehen – oder vielleicht sogar ganz aufhören zu arbeiten.
Charlie wechselte während der Fahrt die Linie und kam in weniger als dreißig Minuten nach Hause. Als er aus der Station trat, befand er sich auf einer schwach beleuchteten Straße. Schwache Lichtflecken fielen aus vereinzelten Laternen und warfen lange Schatten auf den Gehweg. Etwas an der Dunkelheit beunruhigte ihn, ein Gefühl, das noch stärker wurde, als er eine Gestalt aus dem Dunkeln auftauchen sah.
Der Mann, klein und stämmig, tauchte plötzlich neben Charlie auf. Sein Erscheinen war erschreckend, und Charlies Puls beschleunigte sich. Begegnungen wie diese waren in seiner überwiegend weißen Nachbarschaft selten. Obwohl Charlie stolz darauf war, aufgeschlossen zu sein, löste der Anblick eines unbekannten schwarzen Mannes ein Gefühl der Unruhe in ihm aus. Was könnte er wohl wollen?
Der Fremde hatte schon seit Stunden ungeduldig gewartet. Frustration ließ seinen Kiefer anspannen, als er näher kam.
„Sind Sie Charles Bakkendorf?”, fragte er mit starkem Straßenakzent.
Charlie erstarrte. Woher kannte dieser Mann seinen Namen? Er ging schneller weiter, beschleunigte seine Schritte und hoffte, der Fremde würde das Interesse verlieren. Aber der Mann folgte ihm mühelos.
„Ich rede mit dir, Bruder! Bist du Charles Bakkendorf oder nicht?”
Charlie zögerte. Wenn der Mann seinen Namen kannte, war er wahrscheinlich kein Straßenräuber. Dieser Gedanke beruhigte ihn – ein wenig. Er blieb stehen und drehte sich zu dem Fremden um. Das schwache Licht der Straßenlaterne machte es schwierig, das Gesicht des Mannes zu erkennen, und er konnte ihn nicht identifizieren. „Was wollen Sie?”, fragte Charlie vorsichtig.
„Bist du Charlie Bakkendorf?”, drängte der Mann.
„Ja”, gab Charlie zu.
Bevor er noch etwas sagen konnte, trat eine zweite Gestalt aus dem Schatten. Diese war riesig – ein hochgewachsener, zwei Meter großer Gigant mit einem Pferdeschwanz aus graumeliertem Haar und einem dichten Schnurrbart. Das Bandana, das er um die Stirn gebunden hatte, verlieh ihm das Aussehen eines alternden Hippies, obwohl seine Ausstrahlung eher Bedrohung als Frieden vermittelte.
Bevor Charlie reagieren konnte, legte der Riese ihm eine Schlinge um den Hals und zog sie fest zu. Panik brach aus, als Charlie verzweifelt nach Luft schnappte und an dem dünnen Nylonseil kratzte. Doch der Griff des Mannes war unerbittlich. Der Riese stand etwas hinter ihm und vereitelte jeden Versuch, sich zu wehren. Seine Tritte verfehlten ihr Ziel, seine Finger fanden keinen Halt zwischen dem Seil und seiner Kehle. Der Sauerstoff wurde knapp. Die Welt verschwamm. Innerhalb weniger Augenblicke wurde Charlies Körper schlaff.
Der schwarze Mann und der weiße Riese arbeiteten schnell und effizient. Jeder legte einen Arm unter einen von Charlies Armen und stützte ihn wie einen betrunkenen Freund. Für jeden Beobachter hätte das Trio wie eine Gruppe fröhlicher Freunde wirken können, die nach einer durchzechten Nacht nach Hause gingen. Niemand hätte ahnen können, dass Charlie bereits tot war.
Sie erreichten einen wartenden BMW und manövrierten Charlies leblosen Körper auf den Rücksitz, wo sie seine Beine ordentlich unterbrachten. Sobald die Türen geschlossen waren, verbargen die stark getönten Scheiben des Autos seine grausige Fracht. Selbst wenn jemand genau hingesehen hätte, hätte Charlie nur so ausgesehen, als würde er schlafen – abgesehen von der verräterischen roten Linie an seinem Hals.
Der Riese auf dem Beifahrersitz nahm seinen Schnurrbart und sein Bandana ab und enthüllte ein glatt rasiertes Gesicht mit einem militärischen Bürstenschnitt. Mit geübter Effizienz holte er ein neues Nummernschild unter dem Sitz hervor. Überwachungskameras würden das Auto beim Vorbeifahren scannen, aber das neue Nummernschild würde sie auf eine Verfolgungsjagd nach Phantomen schicken. Selbstbewusst und methodisch fuhren die Männer in die Nacht hinein.
Kapitel 2 – AUGEN EINES SPIONS
Äußerlich war es nicht von den vielen Geschäftsgebäuden in der Nähe der Wall Street zu unterscheiden, in deren oberirdischen Räumen geschäftiges Treiben herrschte. Aber 90 Fuß unter seinem Fundament, eingebettet in Manhattans uraltem Basalt, lag ein geheimes Überwachungszentrum, das in der Nacht des 24. Juli 2008 – in der Nacht, in der Charlie Bakkendorf ermordet wurde – aktiv in Betrieb war.
Diese unterirdische Anlage beherbergte ein außergewöhnliches elektronisches Überwachungssystem namens THEATRES, das von Adriano Navarro, einem ehemaligen Soldaten mittleren Alters, der sich zum Technologiearchitekten gewandelt hatte, entwickelt worden war. Navarro hatte es angeblich zum Schutz New Yorks vor Terrorismus konzipiert, doch es diente auch den finanziellen Interessen einiger Megabanken. Diese Institutionen nutzten das System, um sowohl Konkurrenten als auch Kunden zu überwachen und ihre Macht durch allgegenwärtige Überwachung zu festigen.
Das Herzstück von THEATRES war ein Netzwerk aus drei Supercomputern, die über ein dichtes Netz von Glasfaserverbindungen miteinander verbunden waren. Zehntausende Kameras, Mikrofone, Drohnen und andere Sensoren übertrugen Daten in das System, deren Eingaben von hochmodernen Algorithmen verarbeitet wurden, die eine ganze Armee von Analysten übertrafen. Von seinem Aussichtspunkt über dem Kontrollraum aus staunte Navarro über die Reichweite des Systems – eine Errungenschaft, die einst als Science-Fiction galt. Mit einem einzigen Tastendruck konnte er intime Details über das Leben jedes Bewohners abrufen: Beschäftigung, Finanzen, Gesundheitsakten und sogar persönliche Beziehungen.
Trotz seines Stolzes war Navarro ein Mann, der sowohl von körperlichen als auch von emotionalen Narben gezeichnet war. Als Nachkomme italienischer und griechischer Vorfahren stellte er sich gerne als Nachfahre der alten Spartaner vor, Krieger, die für ihre Disziplin und Wendigkeit bekannt waren. Doch die Zeit hatte seine tatsächliche körperliche Leistungsfähigkeit geschwächt. Einst ein schlanker und beeindruckender Kämpfer, zeigte sein Spiegelbild nun graue Schläfen und eine schüttere Kopfbehaarung. Ein starkes Hinken, das Ergebnis eines militärischen Hinterhalts während des Golfkriegs, erinnerte ihn täglich an seine Verletzlichkeit.
Der Hinterhalt hatte ihm eine zertrümmerte Hüfte, einen gebrochenen Arm und zwei amputierte Finger hinterlassen. Obwohl er dank kurdischer Rebellen und einer anschließenden medizinischen Evakuierung nach Deutschland überlebt hatte, veränderte diese schreckliche Erfahrung sein Leben grundlegend. Da er für den aktiven Dienst im Feld untauglich erklärt wurde, entschied sich Navarro, auf eigenen Wunsch zum Verteidigungsnachrichtendienst versetzt zu werden, wo er seine Fähigkeiten im Abhören und in der Überwachungsabwehr verfeinerte – eine Wendung, die schließlich die Aufmerksamkeit der Wall Street auf sich zog.
In dem Chaos nach dem 11. September glänzte Navarro mit taktischer Brillanz. Seine Notfallpläne fanden die Unterstützung der New Yorker Finanzelite und gipfelten in der Gründung von THEATRES. Um verfassungsrechtliche Probleme zu umgehen, wurden die Operationen privatisiert, um sicherzustellen, dass keine Zivilrechtsklagen wegen staatlicher Übergriffe erhoben werden konnten. Bis 2008 war das System eine allgegenwärtige Kraft, die Gesichter, Fahrzeuge und Gespräche mit beispielloser Effizienz erfasste.
Navarro lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und nippte an dem Kaffee, den ihm seine Assistentin Susanna Maloney gebracht hatte. Susanna war klug, effizient und charmant und seit Jahren seine vertraute Mitarbeiterin. Obwohl ihre Anwesenheit manchmal sinnliche Gedanken in ihm weckte, unterdrückte er diese, denn Navarro schätzte ihre Professionalität zu sehr.
Der routinemäßige Abend wurde durch einen jungen Operatör mit beunruhigenden Nachrichten unterbrochen: ein teilweiser Ausfall der Überwachungskameras in Downtown Brooklyn. Navarro humpelte hinter dem jungen Mann her, als sie den Kontrollraum verließen. Momente später standen sie an der Überwachungsstation des Operatörs. Wie erwartet zeigte der Monitor einen leeren Bildschirm.
Navarro setzte sich, stellte die Bedienelemente ein und aktivierte die berührungsempfindliche Zoomfunktion. Die Konsole war benutzerfreundlich und ähnelte einer Videospielkonsole. Er zoomte heraus, bis die Anzeige wieder eine Karte zeigte, die einen großen Teil von Brooklyn abdeckte.
„Da …”, deutete der junge Mann auf einen bestimmten Bereich auf der Karte.
Navarro zoomte heran und klickte auf „Street View”, aber statt eines Videobildes füllte sich der Bildschirm mit Störgeräuschen.
Es war unmöglich, etwas zu sehen oder zu hören. Navarro tippte das Reset-Protokoll ein und wartete. Der Subsystem-Computer startete schnell neu, aber das Problem wurde dadurch nicht behoben. Der Bildschirm und der Lautsprecher blieben voller Störungen.
Navarro blickte auf seine Uhr. Es war jetzt 22
Uhr. Fünf Minuten waren vergangen. Bald würde sich das System selbst wiederherstellen.
„Wir müssen möglicherweise das gesamte System neu starten”, stellte er fest. „Schicken Sie in der Zwischenzeit ein Team der NYPD und eine Reparaturmannschaft in das Gebiet.”
„Ja, Sir”, antwortete der junge Mann. „Aber es wird mindestens zehn bis fünfzehn Minuten dauern, bis die Leute dort sind …”
Wie sich jedoch herausstellte, spielte der Zeitfaktor schnell keine Rolle mehr. Plötzlich, um 22
Uhr, flackerte das entsprechende Videobild wie durch Zauberhand wieder auf dem Bildschirm auf. Obwohl die Gegend dunkel war, war dank der Infrarotbildgebung relativ deutlich zu erkennen, dass ein betrunkener Mann die Straße entlang schwankte und unverständliche Laute von sich gab. Der junge Operatör schüttelte verwirrt den Kopf.
„Das verstehe ich nicht … soll ich trotzdem die NYPD schicken?”, fragte er.
„Lass die ruhig kommen”, antwortete Navarro lächelnd, während er sich mit Hilfe seines Gehstocks auf den Weg zurück in sein Büro machte.
Er drehte sich noch einmal zu dem jungen Mann um und fügte hinzu:
„Und schreib eine E-Mail an das Programmierteam. Ich bin neugierig, was sie dazu sagen …”
Kapitel 3 – FÜNF JAHRE SPÄTER
Jim Bentley schnappte sich seinen Kaffee und machte sich pünktlich um 9
Uhr auf den Weg zu den Autokreditbüros der Bank. Ein weiterer Tag bei Bolton Sayres, ein weiterer Auftrag, den niemand sonst übernehmen wollte. Als junger Anwalt, der in der Bank seines Schwiegervaters arbeitete – eine Position, die er nur durch seine Heirat mit Laura Stoneham, der Tochter des CEO, erhalten hatte –, hatte er die Gelegenheit zu Gerichtserfahrung sofort ergriffen. Aber ein Immobilienzwangsvollstreckungsfall schien für eine Investmentbank bizarr.
Im vierten Untergeschoss war Leroy White gerade dabei, einen burgunderroten BMW 528i zu polieren. Der 60-jährige Zugezogene aus Mississippi verwaltete den Fuhrpark der Bank mit akribischem Stolz. Seine Position verdankte er den politischen Verbindungen seines Schwiegersohnes in der schwarzen Gemeinde von New York. Obwohl er Analphabet war, kannte Leroy jedes Fahrzeug wie seine Westentasche.
„Guten Morgen, Mr. Bentley”, rief Leroy mit einem breiten Lächeln. „Sie ist bereit für Sie.”
Nachdem er Jims Papiere kurz überprüft hatte, reichte Leroy ihm den Zündschlüssel. „Vergessen Sie mich nicht zu Weihnachten”, fügte er mit einem Augenzwinkern hinzu.
Die geräuschlose Kabine des BMW erinnerte Jim an seinen eigenen 2002er Chevy Cavalier, der noch immer in einer Garage in Manhattan stand und verstaubte. Seit seinem Umzug in die Stadt hatte er ihn nicht mehr angerührt. Wozu auch? Die meisten Bankangestellten waren auf Subways und Taxis angewiesen, viele hatten nicht einmal einen Führerschein. Aber Jim fuhr gerne Auto, auch wenn sich dafür derzeit kaum Gelegenheiten boten.
Lauras Worte hallten in seinem Kopf wider: „Geld spielt keine Rolle.”
Das konnte sie leicht sagen – sie hatte nie etwas anderes als Wohlstand gekannt. Sie hatte ihn nach New York gezogen, obwohl er das Stadtleben hasste, und er war ihr aus Liebe gefolgt. Aber seit ihrer Heirat hatte sich alles verändert, besonders nach der Geburt ihrer Tochter. Die dramatische Gewichtszunahme seiner Frau hatte sie in jemanden verwandelt, den er kaum wiedererkannte.
Welche Wahl hatte er? Ihre Tochter brauchte ihn, und er würde seine Verantwortung als Vater nicht aufgeben. Dennoch fragte er sich unweigerlich, was unter all diesen Veränderungen von ihrer Beziehung noch übrig geblieben war. Sie hatten seit Monaten keinen intimen Kontakt mehr gehabt.
Um 10 Uhr morgens fuhr der BMW auf dem New York Thruway in Richtung Norden nach Clarksville, der Kreisstadt von Verde County. Die Fahrt führte ihn aus der Betonwüste Manhattans in die unberührten Catskill Mountains, wo 76.000 Einwohner inmitten von hügeligen Feldern und Touristenattraktionen lebten. Das Gerichtsgebäude – ein Bauwerk aus rotem Sandstein im römischen Stil aus dem 19. Jahrhundert – dominierte die kleine Stadt mit ihren 20.000 Einwohnern.
Um 13
Uhr schlüpfte Jim in den traditionellen Gerichtssaal und nahm mehrere Reihen hinter den anderen Anzugträgern Platz. Vor Richter Floyd Van Hewing saßen zwei Anwälte: Jeb Knight, ein angesehener Anwalt aus Kingston, der für die Vertretung großer Unternehmen bekannt war, und Albert Bennington, ein lokaler Einzelanwalt.
Knight erhob sich, um zu sprechen.
„Euer Ehren, wie mein Kollege in seinen Unterlagen eingeräumt hat, bestimmt § 3212 des New York Code, dass Gläubiger keinen Anspruch auf Lebensversicherungen haben, wenn der benannte Begünstigte den Verstorbenen überlebt.”
„Bedeutet das nicht, dass ich Ihren Antrag ablehnen muss?”, unterbrach Richter Van Hewing ihn.
„Nein, Euer Ehren. Zwar ist unsere Bank einer der Gläubiger von Thomas Mattingly, aber wie Sie wissen, wurden 2009 die Leichen von drei Mitgliedern der Familie Mattingly in ihrem Haus in Paradise gefunden. Die gerichtsmedizinische Untersuchung ergab, dass die Todesursache der Frau und des Sohnes Mord war, gefolgt vom Selbstmord des Vaters …”
„Warum sollte die Versicherungsgesellschaft bei einem Selbstmord zahlen?”, warf der Richter ein.
„Die Police wurde mehr als zwei Jahre vor dem Selbstmord abgeschlossen”, erklärte Knight. „Selbstmordausschlüsse gelten nur für zwei Jahre. Danach wird davon ausgegangen, dass ein Selbstmord nicht aus finanziellen Gründen begangen wurde.”
„Ich verstehe …”
„Niemand bestreitet, dass Sarah Mattingly, die benannte Begünstigte, das Recht auf die Police hatte und dass sie zwei Stunden vor ihrem Mann starb.”
„Was macht das für einen Unterschied?”
„Es bedeutet, dass Sarah ihn nicht überlebt hat. Daher trat ihr Begünstigtenstatus nie in Kraft. Der einzige überlebende Erbe ist Thomas Mattinglys Enkel”, betonte Knight. „Da er jedoch nicht als Begünstigter benannt war und das New Yorker Recht nur benannte Begünstigte schützt, muss das Geld an den Nachlass ausgezahlt werden.”
„Und dann natürlich an die Gläubiger – also an Ihre Bank, richtig?”, schloss der Richter.
„Genau, Euer Ehren.”
Der Richter lehnte sich vor. „Wenn ich Ihrem Antrag stattgebe, wird der Junge praktisch mittellos sein, weil Ihr Mandant jeden Cent nehmen wird, abzüglich der Verwaltungskosten.”
„Das mag sein, Euer Ehren. Aber so lautet das Gesetz, und wir alle haben geschworen, das Gesetz zu achten.”
„Woher wissen wir, dass die Auslassung des Jungen in der Versicherungspolice kein Versehen seines Großvaters war?”, fragte der Richter.
„Das spielt keine Rolle”, argumentierte der Anwalt, „denn es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, dass ein potenzieller Erbe die Lebensversicherungssumme vor dem Nachlass des Verstorbenen erhält, es sei denn, er ist in der Police namentlich genannt.”
„Wie hoch ist die Schuld?”
„Der Kreditrahmen betrug 25 Millionen Dollar. Davon hatte Thomas Mattingly 1,4 Millionen Dollar in Anspruch genommen. Der Schätzwert des Hauses beträgt 738.000 Dollar. Die Restschuld beläuft sich auf 642.545,34 Dollar, einschließlich der Kosten für die Zwangsvollstreckung.”
„Mr. Knight …”, die Stimme des Richters wurde streng. „Zu den Aufgaben dieses Gerichts gehört es, Witwen und Waisen zu schützen …”
„Die Schätzung ist, wenn ich das hinzufügen darf, sehr großzügig”, fuhr Knight unbeirrt fort. „Die Bank wird bei einem späteren Verkauf mit ziemlicher Sicherheit weniger Geld erhalten … aber wir haben zugestanden, das Eigentum zum geschätzten Wert zu übernehmen.”
Der Richter machte sich einige Notizen, während er sprach:
„Mir gefällt nicht, einem Waisenkind seine Versicherungspolice wegzunehmen …”
„Euer Ehren”, erklärte Knight stolz, „Sie nehmen sie ihm nicht weg, denn er hatte sie nie. Bolton Sayres hat seinem Großvater einen Kreditrahmen von 25 Millionen Dollar gewährt, und das mit sehr geringen Sicherheiten. Wir haben ein Recht darauf, dass dieser Kredit zurückgezahlt wird.”
„Warum sollten sie das tun?”, hakte der Richter nach. „Warum sollten sie einem Kreditnehmer bis zu 25 Millionen Dollar leihen, basierend auf Sicherheiten im Wert von nur 700.000 Dollar?”
Knight hielt inne, bevor er antwortete.
„Euer Ehren, es wäre nicht das erste Mal, dass eine Bank jemandem hilft, einen Traum zu verwirklichen, selbst wenn damit ein großes Risiko verbunden ist. Das ist das Wesen des Bankwesens. Deshalb müssen wir dieses Geld eintreiben. Wir arbeiten hart, um unsere Verluste zu begrenzen, damit wir noch mehr Menschen helfen können.”
„Bitte ersparen Sie mir das …”, kommentierte der Richter.
„Thomas Mattinglys Traum”, fuhr Knight fort, „war es, ein Skigebiet zu bauen. Mein Mandant hat versucht, ihm bei der Verwirklichung dieses Traums zu helfen. Er muss zurückgewinnen, was er kann, und selbst wenn wir dieses Geld vom Nachlass eintreiben, werden wir immer noch erhebliche Verluste haben.”
„Ich habe die Catskill Bank of Commerce vertreten, bevor sie übernommen wurde”, murrte der Richter. „So viel Geld zu verleihen mit so wenig Sicherheiten … ehrlich gesagt scheint mir das eine schwerwiegende Verletzung der Treuepflicht gegenüber den Aktionären zu sein. Niemand vergibt Geld, um verrückte Träume zu finanzieren …”
Während Albert Bennington sich auf seine Antwort vorbereitete, überflog Jim hastig die Akte, die er zuvor nicht gründlich gelesen hatte, was er nun bereute. Irgendetwas stimmte hier nicht. Bolton Sayres war eine Investmentbank, die Hypotheken zu Anleihen bündelte – sie vergab selbst keine Hypotheken. Der Fall ergab keinen Sinn. Die Bank handelte mit Aktien, Anleihen und Derivaten, nicht mit Privatkrediten. Die offizielle Bankpolitik verbot ausdrücklich den Besitz illiquider Vermögenswerte, das heißt von Vermögenswerten, die nicht schnell an der Börse gehandelt werden konnten. Immobilienkredite zählten im Allgemeinen zu den illiquidesten Vermögenswerten überhaupt.
Jim war in seinen Gedanken versunken, als der gegnerische Anwalt aufstand, um zu sprechen, und Benningtons Stimme ertönte:
„Euer Ehren, es wäre empörend, einer habgierigen Bank eine Lebensversicherung zuzusprechen!”
Bennington deutete auf eine Frau in der dritten Bankreihe. „Diese junge Mutter ist Witwe – wegen einer schrecklichen Tragödie. Ihr junges, unschuldiges Kind, ein Waisenjunge, weniger als vier Jahre alt, hat keinen Vater mehr. Er hatte einen Großvater, der zweifellos erwartet hätte, dass die Lebensversicherungssumme an seinen Enkel geht. Wird dieser kleine Junge nun vom Staat versorgt werden?”
„Einspruch, Euer Ehren!”, sprang Knight auf.
„Abgelehnt”, sagte der Richter.
„Aber Mr. Bennington appelliert an Ihre Gefühle und möchte, dass Sie das Gesetz ignorieren!”
„Ihr Einspruch wird zurückgewiesen!”, bellte Richter Van Hewing den Anwalt der Bank an und wandte sich dann zu Bennington: „Sprechen Sie – und wollen Sie damit sagen, dass ich das Gesetz ignorieren soll?”
„Natürlich nicht.”
„Welche Rechtsgrundlagen stützen Ihre Position?”
„Der Grundsatz der Fairness und Gerechtigkeit verbietet ungerechtfertigte Bereicherung, ebenso wie der Grundsatz der Nichtberücksichtigung ungeborener Kinder.”
„Einspruch, Euer Ehren”, rief der Anwalt der Bank. „Es gibt keine Regel der Nichtberücksichtigung ungeborener Kinder!”
„Abgelehnt”, sagte der Richter und fragte dann seinen Neffen: „Haben Sie Gerichtsurteile oder Gesetze, die Ihre Argumentation stützen?”
„Nein”, gab Bennington zu und fügte dann leidenschaftlich hinzu: „Aber wir alle wissen, was richtig und was falsch ist.”
„Das hält einer Berufung nicht stand”, murmelte der Richter. „Haben Sie etwas zur Widerlegung, Mr. Knight?”
„Es gibt nichts zu widerlegen. Das Gesetz ist eindeutig. Mr. Bennington kann kein stichhaltiges rechtliches Argument vorbringen, weil es keines gibt. Der Junge ist kein namentlich genannter Begünstigter. Sein Mandant hat keine Chance in diesem Fall. So einfach ist das.”
Der Richter machte sich einige Notizen, während er sprach:
„Meine Herren, ich werde heute keine Entscheidung treffen. Wie Sie wissen, habe ich eine Schlichtung angeordnet, und ich erwarte von beiden Seiten, dass sie sich an Verhandlungen in gutem Glauben beteiligen. Kann ich darauf vertrauen, dass Sie beide das tun werden?”
Beide Anwälte stimmten zu, und während sie ihre Unterlagen zusammenpackten, durchsuchte Jim seine eigenen. Unter den Dokumenten in seiner Aktentasche fiel sein Blick auf das Zwangsvollstreckungsurteil: „In Sachen: Der Nachlass von Thomas Mattingly – Bolton Sayres Holding Corporation gegen den Nachlass von Thomas Mattingly.” Die Kreditunterlagen, die der Klage beigefügt waren, zogen seine Aufmerksamkeit an. In der Zeile für die Unterschrift des Kreditnehmers waren sowohl eine deutliche Unterschrift als auch der vollständige Name in Druckbuchstaben zu sehen. Die Unterschrift der Bank war jedoch völlig unleserlich, und daneben stand kein Name in Druckbuchstaben. Wer bei der Bank hatte diesen unregelmäßigen Kredit genehmigt?
Jim hielt Mr. Knight, den Anwalt der Bank, auf, als dieser zur Tür ging.
„Mein Name ist Jim Bentley”, erklärte er. „Ich arbeite in der Rechtsabteilung von Bolton Sayres.”
„Hallo, Jim.” Knight begrüßte ihn herzlich. „Man hat mir gesagt, dass Sie kommen würden. Lass uns kurz draußen sprechen …”
Im Flur senkte Knight die Stimme: „Wie ich Ihrem Kollegen Tim Cohen bereits gesagt habe, ist dieser Fall ein Kinderspiel.”
„Der Richter schien nicht besonders erfreut darüber zu sein, zu unseren Gunsten zu entscheiden …”
„Wenn er gegen uns entscheidet, werden wir in der Berufung gewinnen. Selbst wenn das Gesetz nicht auf unserer Seite wäre, hätte er sich für befangen erklären müssen – Bennington ist sein Neffe.”
„Was ist mit einer Schlichtung?”
„Nur eine Formalität”, winkte Knight ab. „Der Richter möchte, dass sein Neffe Geld verdient. Wir werden nichts anbieten.”
„Aber dann …”, Jim zögerte und überlegte bereits, eine Vergleichsvollmacht zu beantragen, „warum bin ich dann hier? Wozu das alles?”
„Ehrlich gesagt hat es keinen besonderen Sinn. So war es schon immer. Der Richter verlangt eine Mediation. Konzerne müssen von jemandem vertreten werden, und ich kann nicht der Vertreter sein, weil ich der Anwalt bin. Also bist du hier. So einfach ist das.”
„Klingt nach Zeitverschwendung.”
„Das mag sein, aber so lautet das Verfahren.” Knight zuckte mit den Schultern. „Die Mediation findet um 15 Uhr gegenüber in Benningtons Büro statt – im Lawyer’s Building.”
Im Café des Gerichtsgebäudes aß Jim mechanisch sein Eiersalat-Sandwich, während er versuchte, Murray Sachs, seinen Vorgesetzten, zu erreichen. Die Idee, bei der Mediation nichts anzubieten, gefiel ihm einfach nicht. Selbst eine kleine Einigung wäre besser, als den Jungen mit leeren Händen zurückzulassen. Aber Murray war ein Verfechter der Regeln und hasste Risiken – ohne die Zustimmung seiner Vorgesetzten würde er sich nicht bewegen.
Verzweifelt, nachdem Murray ihn abgelehnt hatte, versuchte Jim, seinen Schwiegervater anzurufen – die höchste Autorität in der Bank. Es war ein riskantes Unterfangen. Jeremy Stoneham hatte nie einen Hehl aus seiner Verachtung für den Mann gemacht, der das Herz seiner Tochter gewonnen hatte. Alles – der Job, das Gehalt – war nur dazu bestimmt, Laura in New York City zu halten. Aber die Sekretärin seines Schwiegervaters war längst darauf trainiert, Jims Anrufe während der Geschäftszeiten nicht durchzustellen. Es war fast 15 Uhr, als Jim aufgab und sich zur Mediation aufmachte.
Benningtons Büro befand sich direkt gegenüber. Als Jim verspätet eintraf, hatten sich bereits fünf Personen um einen langen, polierten Konferenztisch versammelt: Mr. Bennington, Mr. Knight, die Witwe Sandra Mattingly und der vom Gericht bestellte Mediator.
„Entschuldigen Sie, ich bin etwas spät dran …”, entschuldigte sich Jim.
Die Frau entsprach nicht seinen Vorstellungen von einer trauernden Witwe. Sandra Mattingly war schlank und hatte ein frisches, belebtes Gesicht, wie eine unberührte Landschönheit. Ihr sanftes Lächeln, als sie sich die Hände reichten, zusammen mit ihrem braunen Haar, ihren grünen Augen, ihren breiten Hüften und ihrer schmalen Taille – alles beeindruckte ihn augenblicklich. Mit gerade einmal 22 Jahren und einem tief ausgeschnittenen Kleid, das ihre Kurven betonte, wirkte sie überhaupt nicht wie eine trauernde Witwe. Jim rechnete schnell – sie musste mit 17 schwanger geworden sein, kurz bevor ihr Mann starb.
Welche Witwe kleidete sich so provokativ? Natürlich waren seit dem Tod ihres Mannes viele Jahre vergangen. Niemand konnte ewig trauern. Dennoch – jeder kompetente Anwalt hätte dafür gesorgt, dass seine Mandantin angemessener gekleidet war. Bennington profitierte eindeutig vom Ruf seines Onkels. Es war fahrlässig von ihm, sie so zu einer Mediation zu bringen. Der zarte Duft, der von ihr ausging, wehte über den Tisch, und als er sie betrachtete, regte sich in ihm ein unbehagliches Gefühl angesichts der Gefühle, die sie in ihm weckte. Wie konnte eine Frau auf der gegnerischen Seite – noch dazu eine Witwe – ihn so beeinflussen?
Er liebte seine Frau doch, oder? Aber sie hatten schon lange keinen intimen Kontakt mehr. Das endlose Weinen ihres Babys hielt sie nachts wach, und Laura hatte seit dem Stillen kein großes Interesse mehr daran. Wenn er ehrlich zu sich selbst war, lag es jedoch hauptsächlich an ihm – die intensive Anziehungskraft, die er einst für seine Frau empfunden hatte, war zusammen mit ihrer Gewichtszunahme verblasst.
Die Mediation zog sich hin, und Jim merkte, dass seine Sympathie zusammen mit seiner Anziehungskraft wuchs. Als Angestellter von Bolton Sayres war er verpflichtet, die Interessen der Bank zu vertreten. Aber ein seltsamer Gedanke kam ihm in den Sinn. Er hatte keine Befugnis, einen Vergleich zu schließen. Was wäre, wenn er trotzdem Geld anbot? Sein Schwiegervater war CEO der Bank. Sicher, Lauras Vater mochte ihn nicht, und Murray Sachs würde sich vielleicht beim Personalrat beschweren, vielleicht sogar versuchen, ihn zu feuern. Aber letztendlich war Sachs machtlos – er konnte seinen eigenen Job nicht riskieren, und Jeremy Stoneham würde nicht zulassen, dass er gefeuert wurde und seine Tochter mit einem arbeitslosen Ehemann zurückließ. Das war das Schöne an Nepotismus.
Der Gedanke machte ihn unruhig. Seine Beziehungen auf diese Weise zu nutzen, würde ihn zu allem machen, was er verachtete. Normale Anwälte würden für solche Dinge gefeuert werden, aber er war geschützt. Sein Schwiegervater mochte ihn verachten, aber er liebte seine Tochter und seine Enkelin. Jeder Regelverstoß würde unter den Teppich gekehrt werden. Selbst wenn das schlimmste Szenario tatsächlich eintreffen würde und er gefeuert würde, was würde das schon schaden? Er mochte seinen Job sowieso nicht, hasste New York City und wollte wegziehen. Eine Entlassung würde ihm diese Möglichkeit bieten.
Nach mehr als einer Stunde fruchtloser Diskussionen und von Benningtons scheinbar endlosen, maßlosen Forderungen – die hätten wissen sollen, dass er keinen Fall hatte – und ohne Angebote seitens der Bank, konnte Jim es nicht mehr ertragen.
„Im Namen von Bolton Sayres kann ich Ihnen maximal 50.000 Dollar anbieten”, platzte es aus ihm heraus.
Stille herrschte im Raum. Das Gesicht des Anwalts der Bank, Jeb Knight, verlor alle Farbe. Wenn das Angebot angenommen würde, wäre der Fall beendet und damit auch seine lukrativen Honorare. Aber Bennington schüttelte nur den Kopf und deutete das Angebot als Zeichen der Schwäche.
„Kein Cent unter 200.000 Dollar”, wiederholte er. „Wie Sie wissen, wird der Richter diese Familie auf keinen Fall in die Armut treiben.”
„Sie haben eine hundertprozentige Chance zu verlieren, weil das Gesetz gegen Sie ist”, gab Jim zu bedenken, ohne zu berücksichtigen, dass der Richter Benningtons Onkel war.
„Ich nehme an, Sie machen dieses Angebot aus reiner Herzensgüte?”, schnauzte Bennington.
„Ja, eigentlich schon”, antwortete Jim. „Ich versuche nur, diesen Fall abzuschließen, damit die Familie etwas hat. Denn selbst wenn Ihr Onkel zu Ihren Gunsten entscheidet, werden Sie in der Berufung verlieren.”
„Das sehe ich anders!”
„Sie haben keine Gesetze oder Präzedenzfälle auf Ihrer Seite. Das Gesetz spricht eindeutig gegen Sie …”
Dieses Hin und Her dauerte noch eine ganze Weile an. Doch um 16
Uhr hatten sie – sehr zur Erleichterung des lokalen Bankvertreters – noch keine Einigung erzielt. In den Pausen wurde die Wut des Anwalts über das nicht genehmigte Angebot deutlich. Er würde dies sicherlich Murray Sachs melden und eine Disziplinarmaßnahme empfehlen. Aber Jim war das egal. Er wusste, dass 50.000 Dollar für die Bank, die in diesem Jahr Jahresgewinne von 20 Milliarden Dollar erzielen würde, bedeutungslos waren. Natürlich verstießen nicht genehmigte Vergleichsangebote gegen die Bankrichtlinien und die Rechtsethik. Aber Jim kümmerte das nicht. Er wollte einfach nur das Richtige tun.
Die Fahrt in die kleine Stadt Paradise dauerte über eine Stunde durch die kurvenreichen Straßen der Catskills. Die Region war wunderschön, aber nicht alle Berge eignen sich als Skigebiete. Jim wusste genug über Skifahren, um die Idee zu durchschauen. Die Berge in der Nähe von Paradise waren Ausläufer – zu niedrig, zu nah am Hudson Valley und mit zu wenig Schneefall, um lange weiß zu bleiben. Die Konkurrenz durch etablierte Skigebiete wie Hunter Mountain mit unendlich besseren Pisten machte den Plan noch absurder. Nur ein Dummkopf würde einen solchen Kredit genehmigen. Während er fuhr, fragte er sich, wer das getan hatte. Es war nicht klar, wer ihn autorisiert hatte, da auf dem Vertrag kein Name eines Bankvertreters stand und die Unterschrift unleserlich war.
Die Mattingly-Farm sah von weitem wunderschön aus – hügelige Felder vor drei dicht bewaldeten Hängen. Aus der Nähe betrachtet zeigte sich jedoch die Realität: wild überwucherte Felder, ein von Termiten befallener Lattenzaun und ein großes, aber verfallenes Haus aus dem Jahr 1886. Die weißen Holzschindeln waren seit Jahrzehnten nicht mehr gestrichen worden, und die verbliebene Farbe blätterte in großen Stücken ab. Das winterbraune Gras war so hoch, dass es bereits in Samen aufging. Der Ort zerfiel zusehends.
Da kein Immobilienmakler auf ihn wartete, benutzte Jim seinen Schlüssel. Im Inneren empfingen ihn Dunkelheit und muffige Luft. Alle Möbel waren mit Schutzhüllen bedeckt, sogar die Spiegel, bereit für eine lange Abwesenheit. Nach jahrelanger Leerstand waren Spinnweben entstanden, die so groß waren, dass sie die Ecken des Foyers verdeckten. Die polierten Eichenböden hatten unter einer dicken Staubschicht ihren Glanz verloren.
Im Obergeschoss fand er drei Schlafzimmer. Zwei sahen aus, als seien sie seit einem Jahrhundert unberührt, aber das dritte Zimmer stach mit modernen Möbeln von Ethan Allen hervor – nicht billig, wie Jim aus seinen Einkäufen mit Laura wusste. War dies das ehemalige Zimmer des vierjährigen Jungen? Unwahrscheinlich, da er weniger als ein Jahr alt gewesen war, als die Familie nach der ersten Zwangsvollstreckung wegzog. In einer Ecke lagen ein abgenutzter Baseballschläger und ein Handschuh, an den Wänden hingen Logos der Yankees und der Mets. Jim vermutete, dass dies das Kinderzimmer des verstorbenen Vaters war, nicht das seines Sohnes.
Der Gestank in der Luft veranlasste Jim, mit einem verklemmten Fenster zu kämpfen. Während er damit rang, blieb sein Fuß an einer unebenen Diele hängen. Das Fenster sprang schließlich auf, aber er hörte ein lautes Knacken unter seinem Fuß. Als er den Boden genauer untersuchte, stellte er fest, dass das Holz nicht beschädigt war. Stattdessen gab es eine dünne, aufklappbare Öffnung – ein Geheimfach. Darin lag ein dickes, in rotes Leder gebundenes Buch mit goldenen Kanten. Als er den Staub abwischte, kam der Titel zum Vorschein: „TAGEBUCH VON ROBERT MATTINGLY” – dem ermordeten Vater des Jungen, der nun um das Versicherungsgeld seines Großvaters kämpfte.
Er zögerte. Das war etwas Privates, sorgfältig vor neugierigen Blicken versteckt. Aber was konnte es schon schaden, das Tagebuch eines Toten zu lesen? Er schlug eine beliebige Seite auf:
„24. Juli 2008 Liebes Tagebuch: Vor zwei Nächten sahen wir in der Nähe der Straße zwei Männer, die eine Tasche trugen, in der sich offenbar eine Leiche befand …”
„Hallo?”, rief eine Frauenstimme von unten.
Jim schloss schnell das Tagebuch und steckte es in seine Aktentasche.
„Ich bin hier oben!”, rief er zurück.
Die Immobilienmaklerin Jane Simon wartete unten – eine Frau mittleren Alters mit blonden Haaren und blauen Augen. Sie wirkte wie eine ältere, abgenutzter wirkende Version seiner eigenen Frau. Schönheit ist vergänglich, dachte Jim, und genauso wie die von Laura war auch Janes Schönheit verblasst – nicht nur durch das Alter oder durch Geburten, sondern durch eine Reihe von Scheidungen und Beziehungen, von denen keine ihr Kinder geschenkt hatte. Mit Mitte 40 hatte sie gelernt, sich nicht auf Männer zu verlassen, und trotz ihrer beschränkten Schulbildung ihren Weg gemacht, indem sie ländliche Immobilien verkaufte.
Sie tauschten unbeholfene Händedrücke und höfliche Worte aus, bevor sie zur Sache kamen.
„Normalerweise stellen wir den Maklervertrag zur Verfügung”, bemerkte sie, bevor sie sein Papier unterschrieb.
„Ich verstehe, aber bedenken Sie – wir sind eine Bank. Große Bürokratien haben große Regeln, und eine davon ist, dass wir immer die Verträge schreiben.”
Das war wahr und auch nicht ganz wahr. Die Bank versuchte zwar, ihre Verträge selbst zu verfassen. Aber dies war ein Sonderfall. In der Datenbank der Rechtsabteilung gab es kein Standardformular für einen Maklervertrag. Er hatte in der Westlaw-Datenbank nach einer Vorlage suchen müssen und selbst einen individuellen Vertrag entworfen.
Nach einer angenehmen Unterhaltung und einer ausführlichen Besichtigung des Hauses war es Zeit zu gehen.
„Ich melde mich”, versprach sie beim Verlassen des Hauses.
Als sie zu ihren Autos gingen, knurrte Jims Magen.
„Gibt es hier in der Nähe ein gutes Restaurant?”
„Paddy’s Diner”, schlug sie vor. „Da gehen viele Touristen hin. Es liegt in der Innenstadt von Paradise.”
Später, als sie im Diner saßen, blickte Jim auf seine Uhr: Es war fast 20 Uhr. Er holte sein Handy heraus.
„Laura? Ja, ich bin’s … Ich weiß, ich weiß. Es ist spät. Ich wollte das Baby nicht wecken, aber ehrlich gesagt kann ich daran jetzt nichts ändern. Die Sitzung hat länger gedauert und ich musste mir dieses Grundstück ansehen …”
Er seufzte und überlegte, ob er das Tagebuch erwähnen sollte, das ihm jetzt ein Loch in die Aktentasche zu brennen schien. Nein, das war nicht der richtige Zeitpunkt. Und angesichts des Inhalts – angesichts dessen, was darin stand – wollte er das auf keinen Fall am Telefon besprechen.
Kapitel 4 – MARCUS DUNLOP
Am 19. März 2008 glitzerte die Morgensonne auf dem New Yorker Hafen und warf lange Schatten über die luxuriösen Büroräume hoch oben im Bolton-Sayres-Tower. Fünf Jahre bevor Jim Bentley sich auf den Weg nach Norden in die kleine Stadt Paradise, New York, machte, war ein anderer Mann sehr damit beschäftigt, das zu tun, was er fast jeden Morgen tat, während die Freiheitsstatue als stummer Zeuge seiner Morgenroutine dastand.
Mit fünfundzwanzig Jahren galt Marcus Dunlop als eine Größe im Bankwesen. Er war der Sohn von Christopher Dunlop, dem Patriarchen der mächtigen Familie hinter der W. T. Fredericks Bank. Obwohl an seiner Tür der bescheidene Titel „Quantitativer Investment-Analyst“ prangte, war seine wahre Rolle weitreichender. Im Bankwesen bedeuten Titel wenig; die Größe und Lage des Büros verrieten die wahre Stellung. Dunlops Büro war großzügig, mit edlen Möbeln ausgestattet und bot einen atemberaubenden Blick auf den Hafen. All das waren Zeichen echter Bedeutung.
Die junge Frau in seinem Büro zog mit geübter Anmut den Reißverschluss ihrer engen Jeans hoch, richtete die silberne Gürtelschnalle und zog dann ihr rosafarbenes Oberteil an.
„Du machst mich an… du, hübscher Mann“, schnurrte sie in akzentiertem Englisch und fuhr mit den Fingern über seine Brust.
Dunlops perfekt geformte Gesichtszüge verzogen sich zu einem amüsierten Lächeln. Mit seiner beeindruckenden Statur, seinem dunklen Haar und seinen hellbraunen Augen hätte er jede Frau haben können, die er wollte. Aber traditionelle Beziehungen brachten Komplikationen mit sich, die er lieber vermied.
„Du bist wirklich wunderschön, Baby“, sagte er und griff nach seiner Brieftasche. „Aber ich muss arbeiten.“
Ihr Blick wanderte suchend durchs Büro. „Sag mir noch einmal, was du machst?“
„Das ist zu kompliziert…“
„Ich verstehe viele Dinge.“ Ihr Lächeln wurde breiter, als sie sah, wie er den ersten Hunderter hervorholte. Sie fand ihre verlorene Haarnadel und drängte: „Ich bin ein kluges Mädchen… sag mir, was du machst…“
Er musterte sie einen Moment, wissend, dass er nichts preisgeben würde – nicht einmal die bereinigte Version seiner Tätigkeit.
„Ja, du bist nicht nur klug“, sagte er und zupfte nacheinander zehn Hunderter hervor, „du bist auch teuer…“
Für die Außenwelt war Marcus Dunlop ein gewohnheitsmäßiger Lügner, Betrüger, Trinker und Hurenbock. Aber innerhalb des Bankenkartells, wo traditionelle Werte kaum zählten, war er das goldene Kind – ein aufsteigender Stern mit makellosen Verbindungen. Seine wahre Macht lag jedoch nicht in seinem Stammbaum, sondern in der Software, die auf seinen Computern lief.
Marcus hatte ein manipuliertes Spiel entwickelt. Wie ein Casino, das die Karten kontrolliert, sorgte Marcus dafür, dass das Haus immer gewann – nur dass in diesem Fall das „Haus“ eine Handvoll Megabanken war. Seine Computerprogramme ließen es so aussehen, als würden die Banken miteinander konkurrieren, als würden sie Gold und andere Handelsgüter wild kaufen und verkaufen – doch all das war Theater.
Marcus lächelte, als er daran dachte, wie einfach das System tatsächlich war. Im Investmentbanking nennt man das Scheingeschäfte. Die Banken arbeiteten heimlich zusammen und teilten Gewinne und Verluste hinter den Kulissen. Es war wie ein Puppenspiel, bei dem das Publikum verschiedene Puppen kämpfen sah, ohne zu bemerken, dass dieselbe Hand alle Fäden führte. Wenn normale Menschen die fingierten Transaktionen auf ihren Bildschirmen sahen, glaubten sie, die Preise bewegten sich auf natürliche Weise. Sie hatten keine Ahnung, dass sie Theater verfolgten.
Zwischen Bolton Sayres und der Bank seines Vaters, W. T. Fredericks, bestand eine Allianz. Diese Allianz war tiefer, als irgendjemand außerhalb des inneren Kreises vermutete. Wirtschaftszeitschriften beschrieben sie als Konkurrenten. Doch das traf nicht zu. Sie waren Zweige derselben undurchsichtigen Organisation, deren Interessen derart verwoben waren, dass eine Trennung das gesamte System zum Einsturz gebracht hätte. Tatsächlich operierten die beiden Megabanken wie eine Einheit, auch wenn die Eigentumsverhältnisse unterschiedlich waren.
„Für Spitzenqualität muss man eben zahlen, Liebling…“, schnurrte sie und vergaß ihre vorherigen Fragen, während sie die Scheine in ihre Handtasche schob.
Sie setzte sich für eine letzte Umarmung auf seinen Schoß. Dunlop warf einen Blick auf die Uhr: 6:20. So schön sie auch war, das Mädchen hatte überzogen. Seine Besuche bei Prostituierten fanden in der Regel in den frühen Morgenstunden zwischen 4:30 und 5:30 Uhr statt, und die Frauen waren normalerweise spätestens eine Stunde später weg.
„Okay“, sagte er, „aber ich habe noch viel zu erledigen…“
Sie verstand den Wink und schlenderte zur Tür, warf ihm einen koketten Blick zu, lächelte und blies ihm einen Kuss zu.
„Endlich weg“, dachte er und sah zu, wie die Uhr auf 6:30 sprang.
Marcus’ speziell gesichertes Telefon summte exakt zur vereinbarten Zeit. Zeit für den täglichen Anruf aus London. Das Telefon war militärtaugliche Hardware – wie sie Spione benutzen, abhörsicher und nahezu unmöglich zu hacken oder zu orten.
„Ja…?“
„Hallo, Marcus!“
„Was gibt’s in London?“ fragte Dunlop seinen Cousin Jennett, der seinen alten Posten im Londoner Büro von Bolton Sayres übernommen hatte.
„Nichts Ungewöhnliches. Alles normal“, antwortete Jennett.
Dunlop unterdrückte ein Lächeln. Sein Cousin war ein Idiot – genau deshalb hatte er ihn für den Job ausgesucht. Ein Klügerer hätte vielleicht herausgefunden, dass das, was sie auf der privaten Seite ihres Handels für die Bank taten, ein Verbrechen war. Nicht nur ein Gesetzesverstoß – das wäre noch das kleinere Problem gewesen – sondern ein Verstoß gegen die Regeln des Bankenkartells. Wenn zum Beispiel britische Behörden dahinterkämen, könnten selbst die größten Bestechungssummen sie nicht zum Schweigen bringen. Und selbst wenn sie bestechlich wären, würde das ein Vermögen kosten.
„Was hat die Bank of England gesagt?“
„Sie sagten ‚nein‘.“
„Genau das habe ich erwartet.“
„Wozu brauchen wir die überhaupt?“, fragte Jennett verwirrt.
„Weil sie tatsächlich Gold haben und wir nicht“, erklärte Dunlop ungeduldig. „Wenn wir die Papier-Goldpreise auf den Bildschirmen künstlich drücken, kaufen manche Leute echtes, physisches Gold – besonders in Ländern wie Indien und China. Jemand muss es liefern, sonst bricht unser Handelskonstrukt zusammen.“
„Aber sie haben nein gesagt. Irgendwas mit dem Finanzministerium, die würden die Papiere nicht unterschreiben…“
Dunlop seufzte und beschloss, es seinem begriffsstutzigen Cousin ausführlich zu erklären.
„Stell dir vor, du leihst dir das Auto deines Nachbarn“, sagte Marcus. „Die Bank of England verwahrt Gold, das vielen verschiedenen Leuten gehört – Kleinstaaten, reichen Familien, anderen Banken. Die glauben, ihr Gold sei sicher. Aber die Bank of England leiht es uns heimlich aus. Wenn wir es nicht zurückgeben können, verspricht die US-Regierung, es durch amerikanisches Gold aus Fort Knox zu ersetzen. Es ist, als würde dein reicher Onkel einen Kredit mitunterschreiben. Die Formalitäten laufen über eine Schweizer Bank, die auf solche geheimen Deals spezialisiert ist.“
„Aber wem gehört dieses Gold wirklich?“
„Verschiedenen Leuten. Kleinstaaten, Banken, wohlhabenden Privatpersonen. Sie lagern ihr Gold bei der Bank of England zur Verwahrung, aber der Haken ist: Sie bekommen nur eine Quittung, dass sie ‚ein bisschen Gold‘ besitzen – keine nummerierten Barren mit ihrem Namen. Die Bank of England kann also das Gold von jedem für verschiedene Zwecke verwenden, solange sie es ersetzen kann, wenn der Eigentümer es zurückfordert.“
„Warum nehmen wir nicht einfach Gold aus Fort Knox? Das Finanzministerium arbeitet doch mit uns zusammen, oder?“
„Der Kongress würde uns lynchen. Es wäre politischer Selbstmord, an Amerikas Goldreserven zu rühren.“
„Aber was, wenn die Bank of England das Gold zurückfordert?“
„Dann sind wir in ernsthaften Problemen“, gab Dunlop zu. „Aber normalerweise können wir, nachdem wir den Preis abgestürzt haben, Ersatzgold billig von Minengesellschaften kaufen und ersetzen.“
„Und wenn sie nicht unterschreiben? Ich habe fast mein ganzes Vermögen darauf gesetzt…“
Dunlop lächelte über die Nervosität seines Cousins. Er sah gern zu, wie Leute ins Schwitzen gerieten, auch wenn ihm in diesem Fall bewusst war, dass das problematisch sein konnte.
„Das US-Finanzministerium muss die Papiere unterschreiben. Ohne diese Vereinbarungen könnten sie den Goldpreis nicht kontrollieren. Wenn sie diese Kontrolle verlieren, könnten die Menschen dem Gold wieder mehr vertrauen als dem Dollar. Das ist ihr schlimmster Albtraum.“
Dann kam die Bombe.
„Marcus…“ Jennetts Stimme zitterte. „Ich muss dir was sagen… ich… ich habe die Wetten nicht so platziert, wie du gesagt hast…“
„WAS?!“
„Wir verlieren so viel Geld!“, versuchte Jennett zu erklären.
Dunlop hätte seinen Cousin am liebsten durchs Telefon gewürgt. Verstand Jennett denn nicht, dass Verluste auf dem Papier am Anfang immer Teil des Plans waren? Es war wie eine Wette auf ein Pferd in einem Rennen, von dem man weiß, dass es gestellt ist. Man will die besten Quoten. Das funktioniert nur, wenn niemand sonst merkt, dass das Außenseiterpferd garantiert gewinnt. Im Finanzgeschäft heißt das: auf den Gewinner setzen, bevor es jemand anderes begreift.
Die Regierung war kurz davor, die Goldpreise abstürzen zu lassen, aber fast niemand sonst wusste davon. Dunlop und Jennett wetteten heimlich darauf, dass Gold massiv fallen würde. Wenn der Crash kam, würden sie Millionen verdienen. Es war eine einfache Strategie für diejenigen mit Insiderinformationen – man nannte das Vorauswetten. Illegal. Aber extrem profitabel.
Denn die „Wette“ war eigentlich keine Wette. Dunlops Software würde einen Preisverfall herbeiführen, so wie sie es schon viele Male zuvor getan hatte. Der Trick bestand darin, auf fallende Kurse zu setzen – sogenannte Put-Optionen – solange die Preise so hoch wie möglich waren. Man konnte sie nicht alle auf einmal kaufen; man musste sie bei steigenden Preisen nach und nach aufbauen. Wenn der Preis stieg, sahen die Puts zunächst wie Verluste aus. Doch das Timing war alles. Sobald der Crash kam, würden genau diese Puts aufs Mal ungeheuren Gewinn bringen.
„Um Gottes willen!“, platzte er schließlich heraus. „Unsere Leute führen verdammt noch mal das Finanzministerium und die Federal Reserve!“
Es war zu spät. Sein idiotischer Cousin hatte ihnen Millionen an Gewinn gekostet. Die Tragweite des Fehlers schien Jennett allerdings kaum zu berühren. Der Mann dachte nur an eines: Mittagessen!
„Ich geh’ ins Jersey’s Steakhouse“, sagte er fröhlich und merkte Dunlops Wut nicht.
„Ja, klar“, knurrte Dunlop und knallte den Hörer auf. „Scheißidiot!“
Es war jetzt 7:07 morgens.
Er versuchte, das Problem durchzudenken. Was, wenn er heimlich ein paar Put-Optionen an den regulierten Börsen dazukaufen würde? Nein – das war zu riskant. So kurz vor der Operation könnte das Aufmerksamkeit von Regulierern oder sogar vom Kartell selbst erregen. Innerhalb des Kartells gab es eine unumstößliche Regel: Banken als Institutionen konnten enorme Gewinne aus staatlich gestützter Intervention ziehen, aber persönliche Bereicherung war streng untersagt.
Er ging zur Tür und blickte über die Reihen der Bürozellen. Draußen herrschten die Trader – allesamt einfältige Typen. Keiner verstand seine Rolle in der anstehenden Aktion. Sie würden blind der vermeintlichen „technischen Analyse“ folgen, die er gleich ausgeben würde. Keiner würde ahnen, dass sie Teil eines großen Plans waren, den er orchestrierte und den die Regierung unterstützte.
Seine Computerprogramme würden ein schönes Tickerbild erzeugen. Wenn legitime Händler bei Bolton Sayres auf ihre Bildschirme blickten, würden sie vermeintlich verlässliche Signale sehen. Doch diese Signale wären künstlich von seiner Handelssoftware erzeugt, finanziert durch Mittel aus den Kreditfenstern der Federal Reserve. Solche Händler versuchen, Kursmuster in Charts zu erkennen – die sogenannte technische Analyse. Sie reagieren auf das, was sie sehen, indem sie kaufen oder verkaufen, je nachdem, was die Charts ihnen suggerieren.
Hier kommt der raffinierte Teil:
Die Federal Reserve konnte nicht so viel Geld drucken, dass sie den gesamten Goldmarkt bewegte. Das hätte so viel neues Geld erfordert, dass eine außer Kontrolle geratene Inflation die Folge gewesen wäre. Stattdessen würden ein paar Milliarden frisch gedruckter Fed-Dollar als kleines Zündholz dienen, um ein viel größeres Feuer zu entfachen. Die Macht kam daraus, legitime Händler zu täuschen. Wenn diese großen Marktteilnehmer Dunlops gefälschten Mustern folgten, würden ihre enormen Orders die Goldpreise in die von ihm gewünschte Richtung treiben.
Es war, als würde man eine Menge dazu bringen, in eine Richtung zu rennen, indem man „Feuer!“ ruft. Das Feuer muss gar nicht existieren, aber sobald genug Leute rennen, entsteht eine echte Massenpanik. Dunlops Lügen wurden zur Realität, weil die ehrlichen Reaktionen anderer Menschen sie wahr machten. Mit diesem System verdiente man verlässlich Geld. Die Gewinne der Banken aus einer erfolgreichen Operation deckten mehr als die anfängliche Fed-Investition. Persönliche Bereicherung war allerdings verpönt – unter Dieben gibt es einen Ehrenkodex.
Ein Blick auf die Uhr: noch nicht ganz 7:30.
Sein Kontakt im Finanzministerium, Wolff Grubman, hätte längst anrufen sollen. Zweifel nagten an ihm. Sein Cousin hatte sich unberechenbar verhalten – was, wenn der Beamte das auch tat? Ein einziger Zeitversatz konnte alle ihre Nebenwetten zum Kippen bringen und ihn in Schulden stürzen.
Er dachte über Jennetts Fehler nach. Was, wenn er seine Verpflichtungen nicht erfüllen konnte? Was bedeutete es, knapp bei Kasse zu sein? Er konnte es sich nicht vorstellen. Von Taschengeld als Kind bis zu jährlichen Boni war Dunlop immer reich gewesen. Trotzdem öffnete er seine persönliche Investitionsübersicht.
Er starrte auf den Bildschirm. Er hatte bereits 500.000 Dollar für eine Karibikinsel angezahlt – nur die Anzahlung. Der vollständige Kaufpreis von 10 Millionen Dollar stand noch aus, dazu Millionen für Entwicklung: Wellenbrecher, Ufermauern, Herrenhaus, Olympiapool, Tennisplätze, Landschaftsgestaltung, Hubschrauberlandeplatz… alles kostete Geld. Geld, das er durch diese Marktmanipulation zu verdienen geplant hatte. Jennetts Dummheit hatte alles gefährdet.
7:37. Sollte er Grubman anrufen? Nein – das würde nach Panik riechen…
Dann klingelte das Telefon und er schnappte danach.
„Ja?“
„Marcus?“
Erleichterung durchfuhr ihn, als er Grubmans Stimme hörte. Der Mann war Währungsspezialist beim Exchange Stabilization Fund, einer Einheit des Finanzministeriums, untergebracht in der New Yorker Federal Reserve an der Liberty Street. Ein Mann mittleren Alters aus Brooklyn, der seinen dicken Akzent nie verloren hatte.
„Was ist los?“ fragte Dunlop gespannt.
„Ich weiß nicht, ob dir das gefällt, aber…“
Dunlops Hand zitterte leicht am Hörer. Gott sei Dank für reine Sprachanrufe!
„Was? Was ist?“
„Ich habe mich gerade vor ein paar Minuten mit dem Finanzministerium unterhalten.“
„Finanzministerium?“, dachte Dunlop bei sich. „Du BIST das Finanzministerium!“
„Sie brauchen, dass du sofort anfängst.“
Dunlop atmete tief aus; er hatte die Luft angehalten. Das war eine Erleichterung.
„Ausgezeichnet! Ich bin bereit. Ich brauche nur das Bargeld und das Gold.“
„Du kriegst beides“, erklärte Grubman, „aber diesmal wollen sie nur einen Preisverfall von 150 Dollar. Sie wollen einen Punkt machen, aber nicht zu viel Gold verbrauchen, weißt du? Jedenfalls, du bekommst 460 Millionen Dollar in bar für die Leistungsbürgschaften.“
„Das ist nur die Hälfte von dem, was ich verlangt habe…“, beschwerte sich Dunlop.
„Keine Sorge“, antwortete Grubman. „Wir können dir mehr Bargeld geben.“
Natürlich konnten sie das. Die Fed druckte unbegrenztes Geld und verteilte es über ihre sogenannten Kreditfenster. Jede gut vernetzte Bank konnte die theoretischen Übernachtkredite, die über diese Fenster liefen, unbegrenzt verlängern – im Grunde Geschenke. Aber Bargeld war nicht sein eigentliches Problem. Es ging um Gold. Echtes, physisches Gold.
„Mir geht es nicht um Bargeld für die Leistungsbürgschaften…“, sagte Dunlop.
Leistungsbürgschaften sind Sicherheitsleistungen, die es Händlern ermöglichen, massive Goldpositionen am Terminmarkt mit minimalem Kapitaleinsatz zu kontrollieren. Durch Hinterlegung einer bescheidenen Bürgschaft – schon 1.000 Dollar – konnte ein Händler 100.000 Dollar an Goldkontrakten an der COMEX kontrollieren. Der Haken? Das meiste existierte nur auf dem Papier, in Buchungen, nicht in physischen Tresoren. Aber das System funktionierte, weil die Leute daran glaubten.
Große Banken wie Bolton Sayres hatten reichlich Fed-Bargeld, um diese Anforderungen zu erfüllen. Die Marktintervention beruhte hauptsächlich auf Scheingeschäften: Kartellbanken handelten Futures untereinander, um Preise zu manipulieren, und erstatteten sich gegenseitig die Verluste. Das täuschte die externen Trader.
Das wirkliche Nadelöhr war der physische Goldmarkt. Künstlich niedrige Preise riefen in Ländern wie China und Indien Nachfragespitzen hervor. Da Handelsbanken nur etwa ein Prozent des physischen Goldes hielten, das sie auf den Terminmärkten „verkauften“, war eine Knappheit ständig drohend.
Um diese Gefahr zu managen, brauchte man physisches Gold als letzte Reserve. Bargeld allein reichte nicht. Um das kontrollierte Preissystem aufrechtzuerhalten, war echtes Gold nötig – wenn auch deutlich weniger, als die meisten annahmen. Deshalb versorgte das Finanzministerium die Banken bei Bedarf mit beidem: Bargeld und physischem Gold.
Das Ziel war nie, die Goldpreise dauerhaft zu unterdrücken. Das wäre unmöglich gewesen. Ziel war es, die Preise unvorhersehbar zu machen und Privatanleger zu Staatsanleihen und Aktien zu treiben. Periodische Abstürze hielten die meisten davon ab, in Gold zu investieren – genau das Ergebnis, das die Mächtigen wollten: Die Regierung konnte sich leichter verschulden, und Banken verdienten an Aktien- und Anleihegeschäften. Die Manipulationen blieben für die breite Öffentlichkeit unsichtbar.
Und so bellte Dunlop:
„Ich brauche physisches Gold, nicht nur Bargeld.“
„Ihr habt in 28 Jahren keinen einzigen Goldbarren zurückgegeben!“, beschwerte sich Grubman.
„Goldbarren zurückzugeben gehört nicht zu meinen Aufgaben“, insistierte Dunlop. „Ich schütze die Fähigkeit der Regierung, Schulden aufzunehmen.“
„Ich wollte nur erklären, was vor sich geht“, entschuldigte sich Grubman.
Die Knappheit an physischem Gold hatte zwischen 2001 und 2008 zu massiven Preisanstiegen geführt. Das wusste jeder. Die europäischen Regierungen, die überzeugt worden waren, einen Teil des benötigten Goldes zur Unterdrückung beizusteuern, wollten nicht länger mitmachen. Europa war müde vom Verkaufen.
„Sinkende Bestände werden ernst genommen, weißt du“, fuhr Grubman fort. „Wie sollten wir das jemals erklären, wenn die Öffentlichkeit es herausfände?“
„Stabilität hat ihren Preis“, entgegnete Dunlop.
Beide Argumente waren Standard in ihrem Kreis. Stabilität rechtfertigte Opfer. Dieses Opfer bedeutete die fortgesetzte Ausdünnung staatlicher Goldreserven zur Preisunterdrückung. Aber alle wurden nervös über die Leere, falls der Kongress jemals eine ehrliche Prüfung der US-Goldbestände verlangte. Eine solche Untersuchung wäre katastrophal.
„Manche meinen, die Kosten der Interventionen werden zu hoch.“
„Hör zu“, warnte Dunlop, „wenn sie nicht bereit sind, das Gold zu liefern, können wir uns das Ganze abschminken…“
„Das sing’ ich dem Chor, aber die haben Prioritäten über mir. So läuft das…“
„Okay, wie ist die Quintessenz?“
„Du bekommst fünfunddreißig Tonnen.“
„Fünfunddreißig Tonnen?“, fragte Dunlop, deutlich enttäuscht. „Du erwartest, dass ich mit fünfunddreißig Tonnen einen Preisverfall von 150 Dollar schaffe? Ich muss London, die Schweiz, Indien und China koordinieren!“
„Hör zu, niemand erwartet, dass der Verfall von Dauer ist. Das ist nur Show, wegen all dem Gerede über Bankenzusammenbrüche und so…“
„Ich bin kein Zauberer!“, beschwerte sich Dunlop.
„Ich hab’ eigentlich nicht die Erlaubnis, dir das zu sagen, aber…“, zögerte Grubman.
„Sag schon…“
„Sie haben uns tatsächlich 60 Tonnen zugewiesen. Ich soll dir nur 35 sagen, damit du ruhig bleibst, verstehst du?“
„Kein Problem“, antwortete Dunlop. „Ich hab’s nie gehört.“
„Gut“, sagte Grubman, „denn wenn du es wüsstest, würde ich meinen Job verlieren.“
Für einen Moment herrschte Stille, dann fuhr Grubman fort.
„Es gibt noch etwas, worüber ich mit dir reden muss…“
„Was?“
Dunlop verspannte sich. Wolff Grubman war ein widerlicher kleiner Mann – einer, mit dem man zwangsläufig Geschäfte machte. Zu alt, zu sehr Brooklyn, zu niedrig in der Hierarchie, um mehr als ein notwendiger Kontakt zu sein.
„Ich hab’ dich immer fair behandelt, oder?“, fuhr Grubman fort.
„Sicher.“
„Ich geb’ dir immer noch extra Infos, so wie heute…“
„Ja.“ Dunlop konnte nicht leugnen, dass Grubman nützlich war, trotz allem.
„Ich müsste das nicht tun, weißt du“, fügte Grubman bedeutungsvoll hinzu.
Dunlops Herzschlag beschleunigte. Worauf zielte der Mann ab? Wusste er von den Vorauswetten? Die Abmachung war streng vertraulich, geschützt durch einen vertrauenswürdigen bahamaischen Anwalt. Verstöße gegen das bahamaische Bankgeheimnis wurden hart bestraft – die Regierung dort nahm das ernst, weil Schwarzgeldgeschäfte für die Wirtschaft lebenswichtig waren.
„Ich brauch’ was von dir…“
Dunlop spürte einen Kloß im Magen. Mit Jennett zu teilen war schon schlimm genug – er hatte keine Wahl, obwohl sein idiotischer Cousin keinen Cent verdient hätte. Aber von Grubman erpresst zu werden? Das war unerträglich. Allein der Gedanke brachte ihn fast zum Schreien. Er schluckte den Zorn hinunter und sagte vorsichtig:
„Ja, natürlich. Wenn ich dir helfen kann, tu ich’s.“
„Naja, ich denke, es ist Zeit, dass ich mal was für mich kriege…“
„Jetzt kommt die Erpressung“, dachte Dunlop. „Wie viel wird dieser kleine Kerl verlangen?“
„Ich hab’ mich bei W. T. Fredericks beworben“, sagte Grubman schließlich. „Ich will auf deines Vaters Stab.“
Erleichterung durchströmte ihn wie Balsam. Der Mann wusste nichts von seinen Privatgeschäften – und selbst wenn doch, schien es ihm egal zu sein.
„Natürlich hast du meine beste Empfehlung“, sagte Dunlop sofort.
„Danke…“
Das Kartell belohnte seine Freunde – sogar abscheuliche kleine Männer wie Grubman. Jeder Regierungsbeamte wusste das. Deshalb gaben sie Informationen so bereitwillig weiter. Frühere Finanzminister und Fed-Chefs konnten später auf multimillionenschwere Beraterjobs oder CEO-Posten hoffen. Oder sie nahmen Diskretion wählend üppige Rednerhonorare an. Es war ein einfacher Tausch: Regierungsbeamte halfen Banken, reicher zu werden, und später belohnten die Banken sie mit satten Posten. Jeder verstand das Spiel, und jeder war zufrieden.
Es war, als hätte die Mafia die Polizei gekauft. Die Leute, die Finanzkriminalität hätten bekämpfen sollen, wurden selbst reich. Anders als bei der Mafia waren diese Transaktionen jedoch legal – Heerscharen von Bankjuristen sorgten dafür. Es war Korruption in Vollendung. Niemand stellte Fragen. Es geschah in Vorstandsetagen, Country Clubs und in den ehrwürdigen Hallen staatlicher Gebäude – fernab vom Blick gewöhnlicher Menschen.
Aber Grubman war kein großer Spieler. Kein Fed-Chef, kein Finanzminister. Nur ein kleines Rädchen. Die Belohnungen des Kartells skalierten mit Rang und Nützlichkeit. Für jemanden wie Grubman bedeutete das vielleicht keinen Millionenfluss, wohl aber einen bequemen Job, ein repräsentatives Büro und ein hohes sechsstelliges Gehalt – ohne große Verantwortung.
Der Gedanke, Grubman könne auf des Vaters Stab landen, war ihm unangenehm. Würde der Mann noch dort sein, wenn Marcus W. T. Fredericks erbte? Wahrscheinlich nicht – Grubman war beinahe sechzig. Bis dahin würde er vermutlich nicht mehr leben. Das tröstete Dunlop ein wenig.
Er beendete das Gespräch und wandte sich wieder dem Computer zu, um die Bots zu prüfen. Sie waren startklar. Noch vor Tagesende würde sich das Portfolio, das er und Jennett aufgebaut hatten, von tiefem Verlust in substanziellen Gewinn verwandeln. Innerhalb weniger Tage würden alle seine privaten Positionen tief „im Geld“ stehen – wenn auch, wegen seines idiotischen Cousins, nicht so lukrativ, wie sie hätten sein können.
Er warf einen Blick auf die Uhr: 7:55.
Es gab noch umfangreiche Neuprogrammierungen zu erledigen – in den nächsten Tagen würde keine Zeit für seine üblichen Besucherinnen sein. Den Goldmarkt mit nur 60 Tonnen physischem Gold um 150 Dollar zu stürzen war eine Herausforderung, aber er war der Mann dafür.
Kapitel 5 – WIEDER MANHATTAN
Die Fahrt zurück nach Manhattan dauerte den ganzen Abend. Als Jim endlich am Bolton Sayres Tower vorfuhr, stand das riesige Gebäude größtenteils im Dunkeln und war nur von Sicherheitspersonal und ein paar Nachzüglern bewohnt, die noch spät arbeiteten. Das Parkhaus hallte leer wider – ungewöhnlich für ein Bankenzentrum, bis man das Wochenende bedachte.
„Alle Leihwagen sind weg”, dachte er ironisch.
Die Führungskräfte verstoßen gegen die Unternehmensrichtlinien und machen Joyriding. Er schien der Einzige zu sein, der ein Fahrzeug für tatsächliche Geschäftsangelegenheiten nutzte. Er fragte sich, ob das Fehlen des BMW, den er fuhr, vielleicht aufgefallen war. Er konnte fast die Beschwerden der ungezählten verwöhnten, überbezahlten Gören jeden Alters hören, die sich darüber beschwerten, dass ihr Lieblingsfahrzeug für ihren Wochenendausflug in die Hamptons nicht zur Verfügung stand.
Nachdem er den Zündungs-Transmitter in die „Verspätete Rückgabe”-Box geworfen hatte, machte er einen kurzen Abstecher zu einem 24-Stunden-Minimarkt. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt: Wütende Frauen brauchten Süßigkeiten oder Blumen als Friedensangebot. Laura bevorzugte Süßigkeiten, obwohl er ein schlechtes Gewissen hatte, ihr diese zu geben. Ihr zunehmendes Gewichtsproblem… Nun, er konnte seine Rolle dabei nicht mehr leugnen. Er konnte sie genauso gut glücklich machen.
Er nahm sich ein Taxi und bald darauf empfing ihn das fünfstöckige Wohnhaus aus rotem Backstein in Midtown Manhattan, das er und seine kleine Familie ihr Zuhause nannten. Es war kurz nach Mitternacht. Als er die Haustür öffnete, drang eine leise Melodie durch die Wohnung zu seinen Ohren – es war Lauras Stimme, die ein Schlaflied sang und versuchte, das Baby wieder zum Einschlafen zu bringen. Dem Klang folgend, öffnete er vorsichtig die Tür zum Kinderzimmer.
Laura saß mit der kleinen Jenny in einem Schaukelstuhl, und als sie ihn sah, warf sie ihm einen vielsagenden Blick zu, der keiner Übersetzung bedurfte. Sie war offensichtlich sauer darüber, dass er so spät nach Hause kam. Leise ging er zurück und schloss die Tür mit geübter Sorgfalt.
Im Schlafzimmer zog er sich bis auf die Unterwäsche aus und legte seine Kleidung über einen Stuhl. Dann legte er sich hin, und die Erschöpfung übermannte ihn, während er an die Decke starrte. Plötzlich setzte er sich aufrecht hin, als ihm etwas einfiel.
„Das Tagebuch!”, dachte er, sprang aus dem Bett und eilte zum Flur.
Er holte das Buch aus seiner Aktentasche und betrachtete es nachdenklich.
„Ich sollte es wahrscheinlich Sandra Mattingly geben…”, dachte er bei sich, „sie ist schließlich die Testamentsvollstreckerin…”
Aber so einfach war es nicht. Das Tagebuch war offensichtlich Eigentum des Verstorbenen, aber die darin enthaltenen Aufzeichnungen waren potenzielle Mordbeweise. Die Polizei musste es zuerst sehen. Er kehrte ins Bett zurück, fand seine Stelle wieder und las weiter, wo er aufgehört hatte:
„… Unser Verdacht bestätigte sich, als die Tasche beim Tragen riss und ein Männerarm heraushing. Der größere Mann stopfte ihn wieder hinein, aber da wussten wir mit Sicherheit, dass die beiden Männer eine Leiche im Wald vergruben…”
Es war das Tagebuch des ermordeten jungen Mannes – des Vaters des Waisenjungen, dessen Mutter vor Gericht gegen die Bank kämpfte. Aber wer war „wir”? Er blätterte um:
„Es war mein erstes Date mit Sandra, und das war das Letzte, was ich ihr zeigen wollte. Ich wollte ihr nur meine besondere Schlucht im Wald zeigen…”
Er nahm an, dass es sich um dieselbe Sandra Mattingly handelte, die mit Bolton Sayres um die Versicherungssumme ihres angeblich selbstmörderischen und mörderischen Schwiegervaters stritt. Die Daten passten perfekt zusammen – 24. Juli 2008, mit Bezug auf Ereignisse vom 22. Juli.
Jim hätte ununterbrochen weitergelesen, wäre nicht die Schlafzimmertür quietschend aufgegangen und seine Frau hereingekommen.
„Was liest du da?”, fragte Laura, als sie eintrat.
„Nichts Wichtiges.” Jim legte das Tagebuch neben das Bett auf den Boden.
Lauras Blick fiel auf die mit einem roten Band verzierte Schachtel auf der Kommode. „Was ist das?”
„Ein Geschenk”, lächelte er.
Sie ging schnurstracks darauf zu und packte es eifrig aus. Zwei Pralinen verschwanden blitzschnell in ihrem Mund, bevor sie die Schachtel mit zum Bett nahm. Kurz bevor sie sich hinlegte, posierte sie in ihrer neuen Victoria’s Secret-Dessous – ein Anblick, der angesichts ihres Gewichts gemischte Gefühle in Jim hervorrief. Sie beugte sich vor, gab ihm einen Kuss mit Schokoladengeschmack auf die Lippen, schmiegte sich dann an seine Schulter und sah ihn mit hingebungsvollen Augen an.
„Ich kann dir einfach nicht böse sein, weißt du…”, sagte Laura mit sanfter Stimme, während sie sich näher an ihn schmiegte. Dann, etwas ernster: „Du weißt doch, dass wir morgen mit Jennifer in den Zoo gehen?”
Jim nickte. Eigentlich hatte er das nicht mehr im Kopf. Aber die Erfahrung hatte ihn gelehrt, solche Aussetzer möglichst für sich zu behalten.
Ihre Hand wanderte tiefer und streichelte ihn intim – eine offensichtliche Belohnung, die sie ihm als Dank für die Süßigkeiten geben wollte. Ihr teures Parfüm strömte zwischen ihnen, und Jim wurde klar, dass sie Stunden damit verbracht haben musste, diese Verführung zu planen. Aber kein noch so angenehmes Parfüm konnte sein Interesse an ihr wecken. Dieses Ritual, um sich „sexy” zu fühlen: aufwendiges Make-up, teures Parfüm, provokative Dessous – das mochte bei ihr funktionieren, aber bei ihm nicht.
Was an einem Victoria’s Secret-Model verführerisch wirken mochte, hatte einen ganz anderen Charakter, wenn es von jemandem getragen wurde, der doppelt so groß war wie sie. Wie viele Frauen, die ihre Ehemänner lieben, aber nicht wissen, wie sie ihnen gefallen können, schien Laura blind für die einfache Wahrheit zu sein, dass nur eine strenge Diät das heilen konnte, was keine Verpackung verbergen konnte.
„Wie die Mutter, so die Tochter”, dachte er bei sich.
Wenn es ums Einkaufen ging, waren Laura und ihre Mutter, die ebenfalls stark übergewichtig war, wie zwei Erbsen in einer Schote. Sie verbrachten Stunden damit, zusammen einzukaufen, und ließen Baby Jenny bei Isabel – derselben hispanischen Nanny, die Laura großgezogen hatte. Dann kamen sie mit verschiedenen frivolen Einkäufen wie dem Nachthemd von heute Abend zurück, als ob Seide und Spitze eine verwandelnde Magie bewirken könnten.
„Wenn sie nur diese Energie in eine Diät stecken würden”, dachte er bitter.
Aber das würde keine von beiden jemals tun. Konnte er Laura seine wahren Gefühle gestehen? Nein. Das war unmöglich. Der kleinste Hinweis auf ihr Gewicht brachte sie zum Weinen. Und doch war es eine einfache Tatsache. Die Veränderungen hin zur Fettleibigkeit, die seit ihrer Geburt eingetreten waren, stießen ihn ab. Sein Körper reagierte vielleicht vorübergehend auf ihre Berührungen, aber sobald er die Fettfalten spürte, überkam ihn wieder Ekel. Mit ihr zu schlafen war, als würde man ein Walross umarmen.
Er konnte nicht anders, als sich wegen seiner Gefühle schuldig zu fühlen. Liebe sollte doch blind sein, oder? Er liebte sie immer noch, aber er wollte nicht mit ihr zusammen sein. Das war falsch. Aber er konnte nichts dagegen tun. Gefühle sind nicht richtig oder falsch – sie sind einfach, wie sie sind. Er kniff die Augen zusammen und stellte sich die bildhübsche junge Witwe vor, die er an diesem Morgen aus dem Norden des Bundesstaates New York kennengelernt hatte. Er stellte sich Sandra Mattingly nackt vor. Es war eine verdrehte Fantasie. Er fühlte sich deswegen schuldig. Aber im Moment war die einzige Möglichkeit, seinen Körper auf die Berührungen seiner Frau reagieren zu lassen, die Augen zu schließen und von dieser jungen Frau zu träumen.
Nachdem der Akt vorbei war, fühlte er sich leer. Was war aus seinem Leben geworden? Wie hatte es so weit kommen können? Dass er Fantasien über eine andere Frau brauchte, um seine Frau zu befriedigen? Er starrte an die Decke, während Laura einschlief. Dann stand er vorsichtig aus dem Bett auf, holte das rote Tagebuch und schlich sich ins Wohnzimmer. Er ließ sich auf das Sofa fallen und schlug die Seite auf, auf der er aufgehört hatte:
April 2010 –
„Ich habe es Dad endlich erzählt. Was hätte ich sonst tun sollen? Im Wald, direkt unter unserem Grundstück, ist ein Mann begraben, und nur ich weiß davon. An wen hätte ich mich sonst wenden sollen? Sandra würde das nicht verstehen…”
Jim hielt inne, seine Gedanken rasten. Lag die Leiche, von der er sprach, noch immer auf der Mattingly-Farm begraben? Anscheinend war diese scheinbar unschuldige Witwe mehr als nur eine heiße Frau. Sie wusste viel mehr, als sie jemandem erzählt hatte. Dieses Tagebuch könnte alles verändern! Die Polizei lag völlig falsch. Eine heimlich begrabene Leiche deutete auf ein Verbrechen hin, vielleicht einen inszenierten Selbstmord. Aber warum sollte man die gesamte Mattingly-Familie ins Visier nehmen? Und warum verbarg Sandra Mattingly, was sie wusste?
Er überflog die banalen Einträge, bis ihm eine weitere relevante Passage ins Auge fiel:
17. April 2010
„Sandra ist wütend auf mich, weil ich es meinem Vater erzählt habe. Sie sagt, ich hätte versprochen, niemandem etwas zu sagen. Aber ich musste es ihm sagen. Er ist mein Vater. Jedenfalls kann ich jetzt nichts mehr daran ändern.”
Die Uhr zeigte 2
Uhr morgens.
Der morgige Zoobesuch stand bevor. Er sollte schlafen gehen. Aber er konnte nicht aufhören zu lesen. Als langjähriger Fan von Krimis war er fasziniert von diesem spannenden, realen Fall. Aber es war nicht seine Aufgabe, diesen Mord aufzuklären – er musste das Tagebuch den zuständigen Behörden übergeben. Das war seine Pflicht. Als Anwalt wusste er das. Aber wenn er es der Polizei übergab, wäre es danach für immer verschwunden…
Oder doch nicht? Nicht unbedingt…
Dieser letzte Gedanke spornte ihn zum Handeln an. Mit seinem Desktop-Scanner kopierte er sorgfältig jede geschriebene Seite und speicherte die Dateien sowohl auf seinem Laptop als auch auf einem USB-Stick. Nach fast einer Stunde mühsamer Arbeit legte er das Tagebuch zurück in seine Aktentasche und schlich sich wieder ins Bett. Jetzt konnte er das Original der Polizei übergeben und die Kopie zum privaten Lesen behalten. Es war ein Verstoß, aber solange niemand davon wusste, konnte er sich diesen Luxus gönnen.
Er legte sich wieder ins Bett. Doch der Schlaf wollte sich nicht einstellen. Stattdessen schweiften seine Gedanken zu seiner ersten Begegnung mit Laura an der UCLA ab.
Er hatte in der Rechtsbibliothek gelernt, als er sie entdeckt hatte. Sie war damals umwerfend attraktiv – eine von vielen Studentinnen, die während der Prüfungswoche in der Rechtsbibliothek lernten. Viele ihrer Kommilitoninnen gingen aus praktischen Gründen dorthin. Ihre älteren und weiseren Mütter hatten ihnen geraten, dass man sich, wenn man sich schon verliebt, am besten in jemanden verliebt, der viel Geld verdient. Und die meisten von ihnen dachten, dass die Suche nach einem Ehemann in der Rechtsbibliothek diesem Ratschlag entsprach, da viele Anwälte letztendlich sehr gut verdienen. Die Ironie dabei war, dass Laura keinen Ernährer brauchte.
Jim wusste damals nicht, dass das Vermögen ihres Vaters mehrere hundert Millionen Dollar betrug. Aber der Reichtum ihrer Familie schützte sie nicht davor, stark von ihrer Peer-Gruppe beeinflusst zu werden. Sie folgte dem Beispiel ihrer Freunde und übernahm deren gemeinsame Vorstellung, dass es das höchste Ziel sei, einen Jura- oder Medizinstudenten zu ergattern.
Zuerst war Jim zu sehr in seine Lektüre vertieft gewesen, um sie überhaupt zu bemerken. Aber als er aufblickte, fiel ihm etwas Angenehmes ins Auge: ein geblümtes Sommerkleid, seidiges braunes Haar, funkelnde grüne Augen. Ihre zierliche Figur war geschmeidig und gebräunt – ein perfekter Bikini-Körper, dachte er abwesend. Als sie seinen Blick bemerkte, streckte sie sich, lächelte und sprach diese uralte, unausgesprochene Sprache, die keiner Übersetzung bedarf. Jede Bewegung, jeder Ausdruck – alles strahlte Einladung aus, ohne ein einziges Wort zu sagen. Er nahm diese Einladung an, indem er ein Gespräch begann.
„Gutes Buch?”, flüsterte er.
Sie kicherte und hielt ihr Buch hoch.
„Findest du Physik 101 ein gutes Buch?”, lachte sie.
Der Titel überraschte ihn – seiner Erfahrung nach wagten sich schöne Mädchen selten an Naturwissenschaften heran. Er hatte angenommen, dass sie ein Buch aus dem Bereich der Geisteswissenschaften las. Vielleicht über Kunst oder Kultur oder etwas in der Art.
„Ich verstehe”, brachte er hervor und suchte nach etwas Cleverem, „Sie würden sich wundern, wie viele Menschen Physik mögen…”
„Vielleicht, aber das wären dann sicher Nerds…”, neckte sie ihn mit einem weiteren Kichern.
„Ich mag Physik…”
„Wenn der Schuh passt…” Sie lachte. „Ich belege Physik, weil es Teil der naturwissenschaftlichen Anforderungen ist. Sonst würde ich mich nicht damit beschäftigen. Was bist du, ein Physiker?”
„Sehe ich aus wie ein Physiker?”
Sie tat so, als würde sie ihn mustern, dann schüttelte sie den Kopf.
„Wie sehe ich denn aus?”
„Wie eine Jurastudentin”, antwortete sie ohne zu zögern.
„Gut geraten”, lachte er, „ich nehme an, du bist keine Jurastudentin?”
„Bingo!”
„Was macht ein hübsches Mädchen in einer langweiligen Rechtsbibliothek wie dieser?” Er sagte diesen Satz mit absichtlich kitschiger Übertreibung.
„Langweilig ist genau das, was ich gerade brauche. Ich habe Abschlussprüfungen… Ich muss büffeln!”, antwortete sie.
Ihr Flirt wurde durch eine scharfe Stimme zwei Tische weiter unterbrochen.
„Das Problem mit Studenten”, schnauzte Wilma Valdez, „ist, dass sie nicht reif genug sind, um keinen Lärm zu machen!”
Wilma war in der juristischen Fakultät bekannt. Sie war ein kleines, molliges Mädchen mit schulterlangen schwarzen Haaren und aknebefallener Haut. Obwohl sie eine außergewöhnliche Studentin war – Präsidentin der Women’s Law Society, Mitglied des Universitätssenats und Gewinnerin des Moot Court-Wettbewerbs – empfand Jim sie, wie viele männliche Studenten, als unangenehme Präsenz. Sie und andere gleichgesinnte Frauen hatten kürzlich eine Kampagne gestartet, um Studenten aus der juristischen Bibliothek zu verbannen. Bei dieser Kampagne ging es nie wirklich um ruhiges Lernen. Es ging um Eifersucht. Es ging darum, hübsche Studentinnen davon abzuhalten, den männlichen Jurastudenten die wenigen verfügbaren Partner wegzuschnappen. Das würde natürlich niemand zugeben, und wer es so offen aussprach, riskierte, als Frauenfeind oder Schlimmeres abgestempelt zu werden.
„Wilma, beruhige dich… okay?”, begann Jim.
„Oh, nur zu… flirtet mit eurer kleinen Freundin, Jim.” Wilmas Stimme triefte vor Gift. „Flirtet so viel ihr wollt! Ihr werdet es später nur bereuen, wenn ihr die Anwaltsprüfung nicht besteht… Gott! Man könnte meinen, wir wären in einer Single-Bar oder so! Ihr seid so widerlich!”
Bevor Jim zurückschlagen und sich höchstwahrscheinlich Ärger mit der linksgerichteten Schulleitung einhandeln konnte, die solche Kommentare, wie er sie machen wollte, verbot, griff seine neue Freundin ein und rettete ihn.
„Lass uns irgendwo etwas essen gehen…”, sagte sie.
Sie packte bereits ihr Physikbuch ein, überzeugt von seiner Antwort.
„Äh, klar…”, stammelte er und kramte nach seinen eigenen Büchern.
Draußen, auf der Terrasse der juristischen Fakultät, drehte sie sich um und streckte ihm ihre Hand entgegen.
„Ich heiße übrigens Laura Stoneham. Und du?”
Er ergriff unbeholfen ihre Hand – Händeschütteln mit schönen Frauen fühlte sich immer seltsam an.
„Ich bin Jim.”
Sie kicherte und hielt seine Hand länger als nötig.
„Freut mich, dich kennenzulernen, Jim.”
Als er endlich wieder zu sich kam, fragte er:
„Wissen Sie, woher das Händeschütteln stammt?”
„Nein”, antwortete sie.
„Oh, das ist wirklich sehr interessant…”, begann er.
Während sie weitergingen, erzählte er ihr von Kriegern und Schwertarmen und davon, wie diese Geste bedeutete: „Ich werde dich heute nicht töten.” Sie schien von dieser spontanen Geschichtsstunde wirklich unterhalten zu sein.
„Woher weißt du das alles?”, fragte sie.
„Ich lese viel”, antwortete er.
„Ich lese nicht wirklich gern”, gab sie zu.
Das Campus-Café war nur drei Minuten entfernt, und Jim bemühte sich, eine geistreiche Unterhaltung aufrechtzuerhalten, um sie bei Laune zu halten. Sie bestellten das Gleiche – Burger, Pommes und Cola. Als Laura an der Kasse nach ihrer Handtasche griff, schüttelte Jim den Kopf.
„Das geht auf mich”, erklärte er. „Ich übernehme das…”
„Nein…”, widersprach sie, „das glaube ich nicht. Ich kann selbst bezahlen.”
Aber er ignorierte sie und bezahlte trotzdem.
„Das nächste Mal bezahle ich…”, beharrte sie.
Während des Mittagessens schweiften ihre Gespräche von den Abschlussprüfungen zum Anwaltsexamen ab, bis Laura schließlich sagte:
„Mein Vater ist Anwalt…”
„Wirklich?”, fragte Jim.
„Aber er ist nicht als Anwalt tätig. Er arbeitet für eine Bank”, erklärte sie.
Jim nahm sofort an, dass ihr Vater die Anwaltsprüfung nicht bestanden hatte, wie so viele angehende Anwälte, die schließlich Bankmanager oder Versicherungssachverständige werden. Also vermied er von diesem Zeitpunkt an taktvoll das Thema, um sie nicht mit Andeutungen zu verärgern, ihr Vater sei nicht besonders intelligent oder fähig oder habe wahrscheinlich die Anwaltsprüfung nicht bestanden oder ähnliches.
„Das ist interessant”, sagte er stattdessen und fügte hinzu: „Mein Ziel ist es, Prozessanwalt zu werden. Weil ich für die kleinen Leute kämpfen möchte. Für das, was richtig und gerecht ist.”
„Du meinst so etwas wie ein Ambulanzjäger?”, lachte sie.
„Nein.” Er wurde ernst. „Warum sagen die Leute so etwas? Ich spreche davon, das Richtige zu tun, ehrliche Menschen zu vertreten, die vom System betrogen wurden, und gegen korrupte Unternehmen zu kämpfen.”
„Du bist lustig”, kicherte sie.
Dann stellte er plötzlich eine Frage:
„Hast du jemals darüber nachgedacht, in New York City zu leben?”
Sie zögerte, bevor sie antwortete.
„Nein”, sagte sie ehrlich. „Ich war noch nie dort. Ich möchte auch nie dorthin. Ich mag nicht einmal die Vorstellung von New York City… zu groß… zu überfüllt… zu schmutzig. Das Schlimmste, was man sich vorstellen kann…”
„Da komme ich her”, erklärte sie.
Als Jim seinen Fehler bemerkte, versuchte er, einen Rückzieher zu machen.
„Oh”, sagte er. Ihm fiel nichts Besseres ein, aber ihm wurde klar, dass er es möglicherweise gründlich vermasselt hatte. „Äh… warum bist du an die UCLA gegangen und nicht an die Columbia oder die NYU?”
„Weil ich Schauspiel studiere”, antwortete sie. „Die ersten zwei Jahre habe ich an der NYU studiert. Aber ich möchte Filme machen. Ich hatte die Wahl zwischen der USC und der UCLA. Und da die USC in einer schlechten Gegend liegt, wollte mein Vater, dass ich an die UCLA gehe.”
Sie unterhielten sich über ihre Filmambitionen, und dann fragte sie:
„Wenn du Anwältin werden willst, warum bist du dann an die UCLA gegangen und nicht zum Beispiel nach Berkeley?”
„Ich habe mich nie in Berkeley beworben, aber in Stanford.”
„Okay, warum dann nicht Stanford?”, fragte sie.
„Zu teuer. Selbst mit finanzieller Unterstützung hätte ich nach meinem Abschluss Hunderttausende Dollar an Studentenkrediten abzubezahlen. Die UCLA ist günstig. Mit finanzieller Unterstützung werde ich nach meinem Abschluss weniger als 100.000 Dollar Schulden haben.”
„Das ist immer noch eine Schuldenlast, oder?”, kommentierte sie mit gespielter Besorgnis.
„Ja, aber hoffentlich kann ich das zurückzahlen”, sagte er.
Sie hatte nicht mehr als etwa die Hälfte ihres Burgers und ein paar Pommes gegessen, als sie einen Blick auf seinen leeren Teller warf. Sie lachte.
„Nun, gut, dass du Anwalt wirst, denn kein Burgerladen würde dich jemals einstellen… du würdest den ganzen Gewinn auffressen!”
Er lachte mit.
Danach verlief das Gespräch leichter – sie verglichen das Wetter in New York mit dem in Kalifornien, diskutierten darüber, ob Miami oder Los Angeles der wärmere Ort zum Leben sei, und tauschten ihre Meinungen zu unzähligen Themen aus. Schließlich fasste er Mut.
„Möchtest du heute Abend ins Kino gehen?”
Ihr Lächeln war warm, aber entschuldigend.
„Ich kann nicht”, sagte sie, „aber versteh das bitte nicht als Absage. Nur heute Abend nicht…”
„Okay”, sagte er und versuchte, seine Enttäuschung zu verbergen. „Wie wäre es mit morgen Abend?”
Sie schüttelte den Kopf.
„Ich kann nicht”, erklärte sie. „Es ist Prüfungswoche, und wenn ich keine guten Noten bekomme, zwingt mich mein Vater, wieder an die NYU zu gehen.”
Sie holte ein Stück Papier heraus und schrieb etwas darauf.
„Hier, das ist meine Handynummer”, sagte sie und reichte ihm das Papier.
In dieser Nacht ging ihm ihr lächelndes Gesicht nicht aus dem Kopf. Am nächsten Tag rief er sie an, aber sie ging nicht ran und rief auch nicht zurück. Die Tage vergingen. Danach versuchte er es wiederholt. Ihr Bild hatte sich in sein Gedächtnis eingebrannt. Aber er sah sie nie wieder in der Bibliothek. Schließlich, am Tag nach den Abschlussprüfungen, klingelte sein Telefon. Es war Laura, die ihn zurückrief.
„Magst du Opern?”, fragte sie.
Er mochte Oper überhaupt nicht. Der Gedanke, stundenlang unverständlichen Falsettgesang in einer Sprache zu ertragen, die er nicht verstand, ließ ihn erschaudern. Aber sie wiederzusehen, wäre die Qual wert.
„Ich liebe Oper”, hatte er gelogen.
Wie sich herausstellte, sprach Laura fließend Französisch und Italienisch. Sie verstand jedes Wort der Oper und hatte bei den emotionalen Passagen Tränen in den Augen.
In den nächsten zwei Wochen waren sie unzertrennlich. Die kühlen, trockenen Sommernächte Kaliforniens schienen wie geschaffen für junge Liebe. Sie fanden ihren eigenen privaten Ort am Strand von Malibu, wo die Meeresbrise Salz und Verheißung mit sich trug. Barfuß und Hand in Hand spazierten sie und hielten inne, um zu beobachten, wie die untergehende Sonne den Horizont in Farben tauchte. Der Strand war leer, bis auf sie. Er drehte sich zu ihr um und nahm ihr Gesicht in seine Hände. Ihre grünen Augen waren wie tiefe Teiche, ihre Lippen warteten. Der schwache Duft ihres Parfüms vermischte sich mit der Meeresluft. Als er sie näher zu sich zog, konnte er ihre Wärme spüren. Mit diesem Kuss verschmolzen sie miteinander, sanken in den Sand und ihre Leidenschaft erreichte mit den Wellen ihren Höhepunkt. Keiner von beiden ahnte, dass diese Vereinigung neues Leben geschaffen hatte.
Als er im Sand einschlafen wollte, holte ihn Lauras Stimme zurück.
„Jim?”, fragte sie.
„Was?”
„Liebst du mich?”
Er zögerte, da er solche Fragen hasste. Aber diesmal fiel ihm die Antwort leicht.
„Ja”, antwortete er sofort.
Sie küsste ihn erneut, schnell, und setzte sich neben ihn.
„Ich muss nach New York”, sagte sie plötzlich.
Er setzte sich auf und war nun hellwach.
„Was?”, fragte er verwirrt.
„Ich hätte es dir früher sagen sollen”, flüsterte sie. „Es tut mir leid.”
„Ich verstehe nicht…”
„Ich fahre über den Sommer weg. Du solltest mitkommen…”
„Ich muss meine Anwaltsprüfung machen…”, antwortete er.
„Danach”, bat sie ihn.
Seine Gedanken rasten. Natürlich würden ihre Eltern erwarten, dass sie in den Sommerferien nach Hause kommt. Wie würde er mit ihr in Kontakt bleiben? Wie könnte er sicherstellen, dass sie sich nicht mit jemand anderem trifft? Telefonate und Videochats wären in Ordnung, aber sie würden nicht ausreichen. Nichts könnte ihre physische Präsenz, ihre Küsse, ihre Berührungen ersetzen.
„Kannst du warten, bis ich die Anwaltsprüfung gemacht habe?”, fragte er.
Sie schüttelte den Kopf.
„Mein Vater hat das alles schon geplant”, erklärte sie, „aber ich werde nur drei Monate weg sein… und dann komme ich zurück, und wir werden im Herbst wieder zusammen sein.”
Drei Monate lagen wie eine Ewigkeit vor ihm. Eine vertraute Traurigkeit überkam ihn. Es war nicht nur die Angst, sie zu verlieren. Da war auch die alte Trauer über den Verlust seiner eigenen Eltern. Andere, wie Laura, fuhren nach Hause, um ihre Familien zu sehen. Aber er hatte keinen Ort, an den er gehen konnte. Der Tod seiner Eltern auf dem Pacific Coast Highway, als er elf Jahre alt war, hatte dazu geführt, dass er in Pflegefamilien aufgewachsen war. Keine Familie, kein Zuhause, niemand.
„Jim!”, Lauras Stimme in der gegenwärtigen realen Welt unterbrach seinen Traum von der Vergangenheit. „Wach auf! Wir gehen in den Zoo. Erinnerst du dich?”
Er öffnete die Augen und sah, dass sie das Tagebuch in der Hand hielt.
„Was ist das übrigens?”, fragte sie.
„Es ist ein Tagebuch.”
„Wessen Tagebuch?”
„Das ist eine komplizierte Geschichte”, erklärte er.
Sie legte das Buch auf die Kommode.
„Nun, erzähl es mir jetzt nicht. Keine Zeit. Zieh dich an!”
Kapitel 6…Erfahren Sie, wie es weitergeht!
Lesen Sie weiter und entdecken Sie…
• Es steht alles auf dem Spiel. Geld. Mord. Macht. Alles läuft zusammen. Die Wahrheit hinter THEATRES. Dunkler als man sich vorstellen kann. Als Jim sie aufdeckt, wird jemand, den er liebt, sterben.
• Menschen sind nicht, was sie scheinen. Jim ist nicht der saubere Anwalt, als der er sich ausgibt. Lauras Loyalität hat ihre Grenzen. Die Mörder? Sie lauern nicht mehr im Schatten … sie sind Teil des Systems und beobachten deinen jeden Schritt!
• Jeder Faden führt zu einem anderen. Jeder Moment zählt. Jedes Ereignis macht einen Unterschied. Ein Goldbetrug aus dem Jahr 2008. Ein Überwachungsnetzwerk, das in Echtzeit läuft. Alles deutet aufeinander hin.
• Ein Name = DIE BANK = Bolton Sayres.
Die Enthüllung hat einen hohen Preis. Wer zu nah kommt, wird ausgelöscht!
Nach fünf Kapiteln glauben Sie, zu wissen, was passiert. Sie wissen es nicht. Die wahre Verschwörung fängt gerade erst an. Wenn Sie sie durchschauen, hat sich das Schachbrett längst verschoben.
Denn der Einsatz wird höher. Dunkler. Tödlicher. Die Zahl der Todesopfer steigt. LESEN SIE WEITER! Nicht jeder überlebt die Wahrheit. Finden Sie heraus, wer es schafft. Und wer ausgelöscht wird…